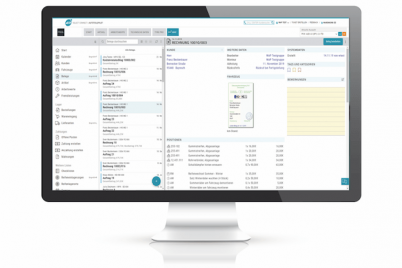Im Zuge der öffentlichen Anhörung durch die Europäische Kommission hat sich der Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (GVA) für eine Fortführung der bestehenden wettbewerbsrechtlichen Regelungen im Kfz-Bereich ausgesprochen. Die derzeit gültige Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung (Kfz-GVO) läuft im Mai 2028 aus. Der Verband betont, dass ohne eine Fortsetzung und Anpassung an die technologische Entwicklung ein funktionierender Wettbewerb im freien Marktumfeld langfristig gefährdet ist.
Bedeutung für unabhängige Marktakteure
Die Kfz-GVO bildet seit Jahren das rechtliche Fundament für faire Marktbedingungen im unabhängigen Teile- und Servicemarkt. Sie sichert den Zugang zu relevanten Ersatzteilen und technischen Informationen und sorgt damit für marktoffene Strukturen – jenseits der Vertriebssysteme der Fahrzeughersteller. Die bisherige Verlängerung der Verordnung wurde auch durch die Initiative europäischer Branchenorganisationen wie FIGIEFA angestoßen und ist aus Sicht des GVA weiterhin notwendig.
Fahrzeuge zählen zu den langlebigen Investitionsgütern, deren Wartung und Instandhaltung nicht ausschließlich durch Herstellerbetriebe erfolgen sollte. Ohne eine klare kartellrechtliche Regelung wäre die Angebotsvielfalt im Werkstattmarkt gefährdet, was sich direkt auf die Preisgestaltung und die Versorgungssicherheit auswirken könnte.
In den vergangenen Jahren hat sich das Verhältnis zwischen Technik und Regulierung weiter verschärft. Die zunehmende Vernetzung moderner Fahrzeuge führt dazu, dass digitale Informationen und Softwarefunktionen eine zentrale Rolle für Diagnose, Wartung und Reparatur einnehmen. Zwar wurde dieser Umstand in den begleitenden Leitlinien der Kommission bereits thematisiert – doch handelt es sich hierbei um keine rechtsverbindlichen Regelungen.
Der GVA spricht sich daher dafür aus, technologische Entwicklungen wie den Zugang zu Fahrzeuginformationen, Steuerungsfunktionen und cloudbasierten Systemen direkt in die Verordnung aufzunehmen. Nur so könne verhindert werden, dass sich neue Abhängigkeiten oder geschlossene Systeme entwickeln, die die Position unabhängiger Marktteilnehmer schwächen.
Zugang zu Daten als Schlüsselfrage
Im Kern geht es um die Frage, wie der Zugang zu sicherheits- und betriebsrelevanten Fahrzeugdaten künftig geregelt wird. Der freie Aftermarket ist darauf angewiesen, diese Informationen ohne diskriminierende Einschränkungen nutzen zu können – sei es für Werkstattbetriebe, Teilegroßhändler oder Diagnoseanbieter. Sollte der Datenzugang künftig ausschließlich von den Fahrzeugherstellern kontrolliert werden, hätte das spürbare Auswirkungen auf die Marktstruktur und die Auswahlmöglichkeiten für Autofahrer.
Der GVA fordert deshalb, den bisherigen Ansatz nicht nur zu erhalten, sondern um bindende Regeln für die digitale Fahrzeugtechnik zu erweitern. Nur mit einem modernen und anwendungsnahen Rechtsrahmen lässt sich die Wahlfreiheit bei Wartung und Reparatur auf Dauer sichern.
Mit Blick auf die kommenden Jahre macht der GVA deutlich: Eine regulierende Verordnung bleibt auch in Zukunft unerlässlich, um die Verfügbarkeit von Serviceleistungen in der Fläche zu gewährleisten. Der freie Zugang zu Ersatzteilen, Diagnosedaten und technischen Schnittstellen darf nicht durch technische Barrieren oder vertragliche Einschränkungen unterlaufen werden.
Nur unter diesen Voraussetzungen bleibt ein marktwirtschaftlicher Wettbewerb möglich – mit positiven Auswirkungen auf Qualität, Preisstabilität und Versorgungssicherheit. Für die Werkstattbetriebe bedeutet dies Planungssicherheit, für Teilegroßhändler stabile Absatzmärkte und für Autofahrer transparente Angebotsvielfalt.
Auswirkungen auf die Teilelogistik im Großhandel
Ein stabiler und rechtlich abgesicherter Aftermarket ist eng mit der Leistungsfähigkeit des Teilegroßhandels verknüpft. Großhändler übernehmen eine zentrale Rolle in der Versorgungskette zwischen Teileherstellern und Werkstätten. Die Kfz-GVO stellt sicher, dass Ersatzteile unabhängig vom Fahrzeughersteller vermarktet und vertrieben werden dürfen – inklusive sogenannter OE-Teile, die technisch identisch mit Originalteilen sind.
Ein Wegfall der Verordnung oder Einschränkungen beim Datenzugang würden die Effizienz der Logistikprozesse gefährden, da Distributoren dann möglicherweise auf herstellerspezifische Schnittstellen oder Zulassungen angewiesen wären. Das hätte Auswirkungen auf Lieferzeiten, Lagerplanung und Preisgestaltung – insbesondere für mittelständische Großhandelsbetriebe mit Fokus auf Mehrmarkenfähigkeit.
Mit der zunehmenden Digitalisierung wandelt sich nicht nur das Fahrzeug selbst, sondern auch der Reparaturalltag in den Werkstätten. Remote-Funktionen, softwaregesteuerte Diagnose und Sicherheitsfreigaben über Hersteller-Server sind längst Realität. Ohne regulatorischen Zugriff auf diese Systeme droht freien Betrieben ein Wettbewerbsnachteil, da sie nicht mehr vollständig auf sicherheitsrelevante oder fahrzeugspezifische Informationen zugreifen können.
Die aktuelle GVO bietet hierfür keine ausreichenden Schutzmechanismen, da sie ursprünglich für physisch zugängliche Komponenten konzipiert wurde. Eine Aktualisierung der Verordnung, die auch digitale Fahrzeugtechnologien berücksichtigt, ist daher zwingend erforderlich, um die Arbeitsfähigkeit unabhängiger Werkstätten zu erhalten.
Marktvielfalt als Garant für Verbraucherinteressen
Ein funktionierender Wettbewerb bringt nicht nur betriebswirtschaftliche Vorteile für Teilehändler und Werkstätten, sondern sichert auch die Interessen der Endverbraucher. Der freie Zugang zu alternativen Ersatzteilen und Serviceleistungen sorgt dafür, dass Preise vergleichbar bleiben und Leistungen transparent angeboten werden. Gerät dieser Mechanismus ins Wanken – etwa durch monopolartige Strukturen beim Datenzugang – verlieren Verbraucher die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Anbietern zu wählen. Das betrifft vor allem Besitzer älterer Fahrzeuge, für die der Besuch einer markengebundenen Werkstatt häufig wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist. Die Gruppenfreistellungsverordnung wirkt diesem Risiko entgegen und ist daher auch aus verbraucherpolitischer Sicht unverzichtbar.
Unternehmen im freien Automotive Aftermarket investieren kontinuierlich in Schulung, Diagnosetechnik und digitale Prozesse. Diese Investitionen setzen stabile Rahmenbedingungen voraus, insbesondere wenn es um langfristige Technologieprojekte oder den Aufbau datenbasierter Services geht. Die aktuelle Unsicherheit über die künftige Ausgestaltung der GVO hemmt in Teilen diese Entwicklung. Klare und verbindliche Vorgaben in Bezug auf Datenzugang und Interoperabilität würden nicht nur den freien Wettbewerb stärken, sondern auch Innovationskraft fördern – etwa im Bereich vorausschauender Wartung, Flottenmanagement oder emissionsarmer Reparaturprozesse. Die GVO sollte daher auch als Instrument verstanden werden, das technologische Entwicklung im freien Markt aktiv absichert.
Fazit
Die Verlängerung der Kfz-Gruppenfreistellungsverordnung ist aus Sicht der freien Teile- und Werkstattbranche unverzichtbar. Gleichzeitig muss der gesetzliche Rahmen an die aktuellen technischen Entwicklungen angepasst werden. Der offene Zugang zu digital gesteuerten Fahrzeugsystemen muss rechtlich gesichert werden, um den fairen Wettbewerb auch im Zeitalter der Fahrzeugvernetzung zu gewährleisten. Die Europäische Kommission steht vor der Aufgabe, den bewährten Rechtsrahmen fortzuschreiben und zukunftssicher zu gestalten. Quelle: GVA