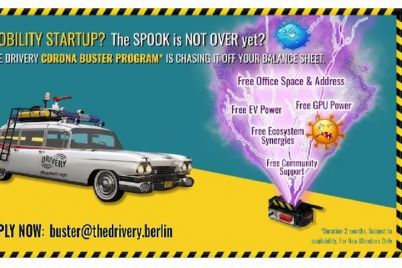Mit der Vorstellung der Binnenmarktstrategie will die Europäische Kommission Hindernisse im grenzüberschreitenden Geschäftsverkehr abbauen und die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen stärken. Der VDA bewertet die grundsätzliche Stoßrichtung positiv, sieht jedoch Lücken in der konkreten Umsetzung und vermisst klare Antworten auf zentrale Zukunftsfragen.
Positiv: Fortschritte bei Bürokratieabbau und digitalem Binnenmarkt
Der VDA hebt hervor, dass eine generelle Entschlackung des europäischen Regelwerks zu begrüßen sei. Neue Gesetze sollen klarer gefasst, bestehende Vorgaben überprüft und vereinfacht werden. Ein konkretes Ziel zur Reduktion der Verwaltungskosten, etwa eine verbindliche Absenkung um ein Viertel, hätte jedoch zusätzlich Klarheit und Verbindlichkeit schaffen können.
Auch bei der stärkeren Digitalisierung von Verwaltungsverfahren sieht der Verband Potenzial. Wenn Unternehmen künftig Verwaltungsdokumente EU-weit online einreichen und Informationen digital einsehen können, fördert dies vor allem die grenzüberschreitende Geschäftstätigkeit kleinerer Firmen. Der VDA begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der Kommission, solche Prozesse EU-weit zu harmonisieren.
Darüber hinaus werden Entlastungen bei Berichtspflichten, insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit, als sinnvoller Schritt gewertet. Dies komme mittelständischen Unternehmen entgegen, die oft nicht über die Ressourcen verfügen, komplexe Offenlegungspflichten zu erfüllen.
Grenzüberschreitender Mitarbeitereinsatz: Praktischer Fortschritt
Ein weiteres positives Signal ist aus Sicht des VDA die angekündigte Erleichterung beim temporären Einsatz von Mitarbeitenden in anderen EU-Staaten. Gerade für Dienstleistungs- und Wartungseinsätze sei eine unkomplizierte Entsendung von Fachkräften notwendig. Durch vereinfachte Verfahren könnten Projekte effizienter abgewickelt und personelle Ressourcen flexibler eingesetzt werden.
Der VDA sieht in der vorgesehenen Obergrenze von 749 Mitarbeitenden für sogenannte „Small Mid-Caps“ ein zentrales Manko der Strategie. Damit bleibe ein erheblicher Teil des industriellen Mittelstands außen vor, obwohl gerade dieser die wirtschaftliche Stärke Europas maßgeblich mitträgt. Eine angepasste Grenze von bis zu 3.500 Beschäftigten würde dem tatsächlichen Bedarf besser entsprechen. Der Verband fordert daher eine klar abgegrenzte Mid-Cap-Kategorie, die regulatorisch wie fördertechnisch Berücksichtigung findet.
Ein besonders kritischer Punkt aus Sicht der Automobilindustrie ist die fehlende Initiative zur Vereinheitlichung der Unternehmensbesteuerung in der EU. Die aktuellen nationalen Steuersysteme verursachen hohen bürokratischen Aufwand und erschweren Investitionen über Ländergrenzen hinweg. Eine koordinierte europäische Lösung könnte nicht nur die steuerliche Belastung senken, sondern auch für mehr Transparenz und Planbarkeit sorgen.
Regulierungsdefizite beim automatisierten Fahren
In Bezug auf technologische Entwicklungen wie automatisiertes Fahren sieht der VDA eine deutliche Leerstelle in der Strategie. Es fehle an einem einheitlichen europäischen Verfahren für die Genehmigung entsprechender Fahrzeuge. Die derzeitige nationale Fragmentierung erschwere die Einführung automatisierter Fahrfunktionen erheblich. Aus Sicht der Industrie ist ein kohärenter europäischer Regulierungsrahmen notwendig, um die Innovationsfähigkeit zu sichern und Investitionssicherheit zu schaffen.
Mit Blick auf technische Vorschriften warnt der Verband zudem vor einer potenziellen Aushöhlung des bewährten Normungssystems. Wenn anstelle einheitlicher Normen künftig vermehrt sogenannte Spezifikationen Anwendung finden sollen, bestehe die Gefahr eines weniger transparenten und verbindlichen Regelwerks. Der VDA plädiert deshalb dafür, harmonisierte Normen als Standard beizubehalten und die Einführung alternativer Vorgaben klar zu begrenzen.
Bedeutung des Binnenmarkts für die Automobilwirtschaft
Die Automobilbranche zählt zu den Schlüsselindustrien in Europa und ist besonders stark auf funktionierende Binnenmarktmechanismen angewiesen. Hersteller, Zulieferer und Handelspartner agieren europaweit in komplexen Wertschöpfungsketten. Produktionsstätten, Entwicklungszentren und Vertriebskanäle sind über Ländergrenzen hinweg eng verzahnt. Gerade deshalb sind einheitliche Standards, reibungslose Lieferprozesse und abgestimmte regulatorische Rahmenbedingungen essenziell. Verzögerungen durch unterschiedliche nationale Vorschriften führen nicht nur zu erhöhtem Aufwand, sondern auch zu Wettbewerbsnachteilen gegenüber Standorten außerhalb der EU.
Ein erheblicher Kostenfaktor im europäischen Binnenmarkt ergibt sich durch die Vielzahl nationaler Zulassungs- und Genehmigungsverfahren. Produkte, Dienstleistungen und Prozesse müssen oft in mehreren Mitgliedstaaten separat genehmigt oder registriert werden. Für international tätige Unternehmen bedeutet dies zusätzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand. Besonders im Bereich neuer Technologien, etwa bei intelligenten Fahrerassistenzsystemen oder digitalen Mobilitätslösungen, führt das zu Verzögerungen bei Markteinführungen. Der VDA fordert daher einheitliche Genehmigungswege, die in allen EU-Staaten gleichermaßen anerkannt werden – insbesondere für innovative, grenzüberschreitend eingesetzte Technologien.
Rolle der EU in globalen Wettbewerbsfragen
Der wirtschaftliche Wettbewerb findet längst nicht mehr nur auf nationaler oder europäischer Ebene statt. Staaten wie die USA und China setzen zunehmend auf strategische Industriepolitik, massive Subventionen und staatlich unterstützte Innovationsprogramme. Vor diesem Hintergrund ist ein handlungsfähiger und effizient regulierter EU-Binnenmarkt ein entscheidender Standortfaktor. Nur mit harmonisierten Regeln, geringem Verwaltungsaufwand und investitionsfreundlichen Rahmenbedingungen kann Europa gegenüber globalen Wettbewerbern bestehen. Der VDA plädiert deshalb dafür, die Binnenmarktstrategie nicht isoliert zu betrachten, sondern als Baustein einer umfassenden wirtschaftspolitischen Gesamtstrategie.
Zahlreiche EU-Förderprogramme richten sich vorrangig an Kleinstunternehmen oder Start-ups. Für mittelständisch geprägte Industrieunternehmen – speziell in kapitalintensiven Branchen wie der Automobilzulieferung – sind viele dieser Programme jedoch weder passgenau noch praxistauglich. Der VDA fordert daher eine differenziertere Ausrichtung der Förderlogik: Programme müssen sowohl an Unternehmensgröße als auch an branchenspezifische Anforderungen angepasst werden. Dies gilt vornehmlich für Investitionen in Transformation, Dekarbonisierung und Digitalisierung. Ohne einen gezielten Zugang zu geeigneten Fördermitteln verliert der industrielle Mittelstand an Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit.
Fazit
Die Binnenmarktstrategie der EU zeigt eine grundsätzliche Bereitschaft, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen zu verbessern. Die Initiativen im Bereich Bürokratieabbau und Digitalisierung werden als zielführend bewertet. Entscheidend ist jedoch, dass auch die strukturellen Herausforderungen des industriellen Mittelstands sowie die regulatorischen Bedingungen für Zukunftstechnologien wie automatisiertes Fahren adressiert werden. Die Strategie darf kein Sammelsurium unverbindlicher Absichten bleiben, sondern muss in konkrete und praxisnahe Maßnahmen münden. Quelle: VDA