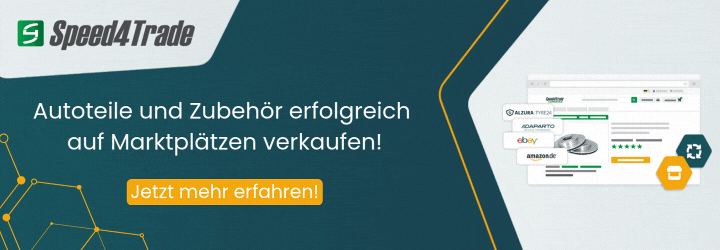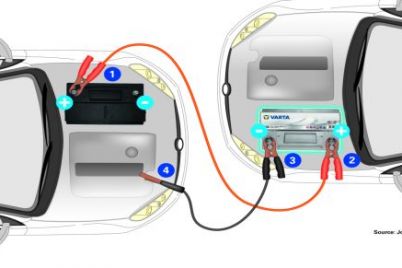Der Verband GVA setzt sich für fairen Zugang von Fahrzeugdaten ein. Thomas Vollmar, GVA Präsident betonte die aktuellen Themen. Trotz klarer Rechtslage zur Datenverfügbarkeit in Fahrzeugen sehen sich freie Werkstätten und Teilehändler weiterhin mit erheblichen Hürden konfrontiert. Der Zugang zu Diagnosedaten, OE-Informationen und Teilenummern ist oft eingeschränkt, überteuert oder technisch kompliziert. Auf der politischen Ebene sind mit dem „Delegated Act“ und einschlägigen Urteilen zwar wichtige Grundsatzentscheidungen gefallen – die praktische Umsetzung bei Fahrzeugdaten ist jedoch nach wie vor lückenhaft. Zentrale Themen bleiben der Zugang über die VIN, das Preisniveau für Diagnosedaten sowie die strategische Rolle von Datenplattformen.
Enforcement: Rechte von Fahrzeugdaten durchsetzen statt nur besitzen
Die wohl größte Herausforderung für den IAM bleibt derzeit das sogenannte „Enforcement“ – die aktive Durchsetzung rechtlich bestehender Zugangsrechte. Zwar hat der Europäische Gerichtshof mit deutlichen Urteilen etwa im Fall Carglass/A.T.U. gegen Stellantis zugunsten des freien Marktes entschieden, doch bleibt die Umsetzung auf Seiten der Fahrzeughersteller in vielen Fällen aus.
Ein zentrales Problem: Ohne massiven Druck durch Verbände wie den GVA oder juristische Nachverfolgung setzen Hersteller Regelungen oft nicht oder nur selektiv um. So bleibt der Zugriff auf Steuergeräte, OE-Teilenummern oder RMI-Daten (Repair and Maintenance Information) in vielen Fällen stark eingeschränkt oder ist an überzogene Gebührenmodelle geknüpft – ein Vorgehen, das rechtlich fragwürdig, aber in der Praxis wirksam ist, solange niemand dagegen vorgeht.
Diagnosedaten: Zugang ja, aber zu welchem Preis?
Ein besonders kontroverses Thema bleibt die Preisgestaltung beim Zugang zu Diagnosedaten. Während viele Hersteller mittlerweile formell die erforderlichen Informationen bereitstellen, belaufen sich die Kosten für die Nutzung der Schnittstellen auf Summen, die für viele Betriebe ruinös wären. Beispiel BMW: Hier wurden Lizenzgebühren von bis zu 800.000 Euro aufgerufen – ein Betrag, der in keinem Verhältnis zur betrieblichen Realität steht.
Für den IAM ist klar: Ein kostendeckendes Geschäftsmodell für Diagnosesysteme ist unter solchen Bedingungen kaum mehr möglich. Sollte sich dieses Preismodell durchsetzen, könnte das freie Werkstattnetz ernsthaft gefährdet werden – mit direkten Folgen auch für den Teilegroßhandel.
VIN-basierte Teileidentifikation: Schlüssel für passgenaue Reparatur
Die eindeutige Identifikation von Ersatzteilen über die Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) gewinnt zunehmend an Bedeutung – besonders bei komplexen oder mehrfach verbauten Komponenten. Industrie und Handel drängen auf bessere Teileidentifikation. Aktuell ist etwa bei 20 % der Teileidentifikation keine eindeutige Zuordnung möglich, was zu fehlerhaften Bestellungen und erhöhtem Aufwand in Werkstätten und im Handel führt. Besonders kritisch ist die Situation bei sicherheitsrelevanten Teilen, wo kleine Unterschiede große Folgen haben können.
Die Forderung aus dem IAM: Vollständige, automatisierte VIN-Abfragen in Echtzeit mit Rückmeldung vom Fahrzeughersteller – idealerweise über eine standardisierte Schnittstelle. Die Daten-Plattformen stehen hier nicht nur technisch, sondern auch wirtschaftlich unter Zugzwang. Neue Wettbewerber aus der Industrie könnte die Innovationsgeschwindigkeit erhöhen. Auch aus der Industrie. Als Beispiel nannte Vollmar, den Zulieferer Denso. Auf deren Website gibt es bereits eine VIN-basierte Teileidentifikation für jeden User.
OE-Nummern und stille Rückrufe: Datenlücken mit Risiko für die Teileidentifikation
Ein weiteres Problemfeld ist die Bereitstellung vollständiger OE-Teilenummern und Zusatzinformationen, etwa zu stillen Rückrufen oder fahrzeugspezifischen Bauteilvarianten. Während Vertragswerkstätten über interne Systeme problemlos auf diese Daten zugreifen können, bleiben freie Werkstätten vielfach außen vor – mit direkten Folgen für Qualität und Sicherheit.
Insbesondere bei Modellen mit Zwischenserien bzw. kurzfristigen Bauteilwechseln z. B. Mercedes baute in die E-Klasse eine Lichtmaschine der C-Klasse ein. Dies zwar nur für wenige Monate. Doch für Fahrzeuge in dieser Produktionzeit ist die Referenzierung und klare Identifikation nicht möglich. Eine saubere Identifikation ohne VIN-Zugriff ist nahezu unmöglich. Teilehändler müssen hier entweder aufwändig nachrecherchieren oder Mehrfachlieferungen in Kauf nehmen – eine Ineffizienz, die sich wirtschaftlich wie ökologisch negativ auswirkt.
Fahrzeugdaten: Fluch und Segen zugleich
Datenplattformen wie TecAlliance spielen eine zentrale Rolle bei der Verfügbarkeit technischer Informationen und Teilenummern. Doch auch hier zeigen sich Schwächen: Die Aktualität der Daten, der Rückkanal zu den Herstellern und die Möglichkeit zur VIN-basierten Echtzeit-Abfrage sind nicht überall gewährleistet.
Wenn die Teileidentifikation nur auf OE-System machbar ist werden, werden diese wahrscheinlich auch bevorzugt dort bestellt. Das führt nicht nur zu Verkaufsverlusten im freien Handel, sondern auch zu höheren Kosten für den Endkunden, was der GVA immer wieder betont. Freie Markt führt zu geringere Endverbraucherkosten.
Juristische Klarheit, aber politische Unsicherheit bei Fahrzeugdaten
Trotz klarer Urteile bleibt die politische Entwicklung offen. Mit dem Delegated Act wurde ein wichtiger Schritt getan, doch die technische Entwicklung geht schneller als die Gesetzgebung. Der nächste Meilenstein wird die Überarbeitung der Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) ab 2028 sein – ein Prozess, der bereits begonnen hat. Themen wie E-Mobilität, Over-the-Air-Updates oder digitale Fahrzeugplattformen müssen dabei berücksichtigt werden.
Ein offenes Feld bleibt auch der Umgang mit chinesischen Fahrzeugherstellern, deren Markteintritt in Deutschland durch aggressive Preismodelle und staatliche Subventionen erleichtert wird. Hier stellt sich nicht nur die Frage nach fairen Wettbewerbsbedingungen, sondern auch nach Datenzugang, Reparaturfähigkeit und Markenschutz.
Fahrzeugdaten: Mehr Klarheit, aber Umsetzung bleibt eine Baustelle
Trotz wichtiger juristischer Fortschritte bleibt die praktische Realität für freie Werkstätten und Teilehändler eine Herausforderung. Ohne konsequente Durchsetzung bestehender Rechte – auch durch gerichtliche Auseinandersetzungen – droht die freie Reparatur zunehmend zum Nischenmodell zu werden. Der Zugang zu Diagnosedaten, OE-Informationen und die eindeutige VIN-basierte Teileidentifikation müssen schnellstmöglich auf ein praktikables Niveau gebracht werden – technisch wie wirtschaftlich. Nur so kann der Independent Aftermarket seine Systemrelevanz langfristig behaupten. Q: GVA Conference
FAQ
Warum ist VIN-basierte Teileidentifikation so wichtig?
Über die VIN lassen sich Fahrzeugteile eindeutig und passgenau identifizieren. Ohne VIN-Zugriff besteht die Gefahr von Fehlbestellungen oder Sicherheitsrisiken durch falsche Komponenten. Besonders bei Modellüberlappungen oder stillen Rückrufen ist die VIN die verlässlichste Datenquelle.
Welche Probleme gibt es beim Zugriff auf Diagnosedaten?
Zwar ist der Zugriff rechtlich geregelt, doch hohe Lizenzkosten und technische Barrieren verhindern eine faire Nutzung für Werkstätten und insbesondere Publisher. Beispiel: BMW verlangt teils über 800.000 Euro für den Datenzugang – für viele Anbieter wirtschaftlich nicht tragbar.
Wie hilft der „Delegated Act“ dem freien Aftermarket bei Fahrzeugdaten?
Der Delegated Act definiert technische Standards und Zugangsrechte für Werkstätten und Teilehändler. Er stellt sicher, dass Fahrzeughersteller keine Hürden beim Datenzugang aufbauen dürfen. Allerdings muss seine Umsetzung auch kontrolliert und durchgesetzt werden.