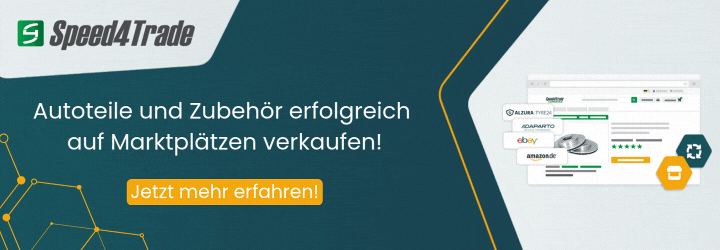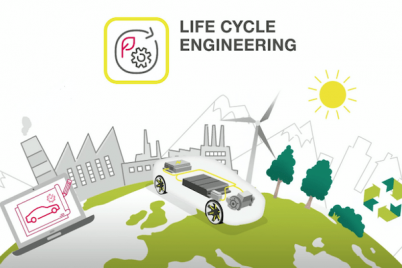In einer Marktstudie hat der ADAC untersucht, wie sich das Angebot an Dieselmodellen in den vergangenen zehn Jahren verändert hat. Das Ergebnis zeigt einen deutlichen Rückgang. Vor allem Kleinwagen mit Dieselmotor sind nicht mehr erhältlich. In höheren Fahrzeugklassen bleibt der Diesel zwar vertreten, doch auch hier nimmt die Modellvielfalt kontinuierlich ab.
Rückgang der Dieselmodelle im Überblick
Zu Beginn der 2000er Jahre war der Dieselantrieb noch die dominierende Wahl vieler Autofahrer. Rund jedes zweite Neufahrzeug in Deutschland wurde mit einem Selbstzünder ausgeliefert. Heute liegt der Marktanteil bei nur noch gut 20 Prozent. Betrachtet man den Zeitraum zwischen 2015 und 2025, ist ein Rückgang von mehr als der Hälfte zu verzeichnen.
Besonders stark zeigt sich diese Entwicklung in den kleineren Fahrzeugsegmenten. Während es vor zehn Jahren noch 47 Dieselvarianten in Klein- und Kleinstwagen gab, ist dieses Segment mittlerweile vollständig verschwunden. Auch in der Mittelklasse, die lange als Diesel-Hochburg galt, ist das Angebot spürbar geschrumpft. Von ehemals zahlreichen Modellen sind heute nur noch wenige Kombis mit Selbstzünder verfügbar.
In der oberen Mittelklasse und der Oberklasse ist der Rückgang weniger drastisch, aber dennoch erkennbar. Hersteller reduzieren hier schrittweise die Zahl der Modelle, auch wenn nach wie vor Fahrzeuge mit Dieselantrieb erhältlich sind.
Eine Ausnahme bildet das Segment der Kleinbusse. Diese Fahrzeuge profitieren von den technischen Vorteilen des Diesels, da sie mit höherem Gewicht und größerem Platzangebot konstruiert sind. Hier ist die Nachfrage stabil geblieben, in einigen Bereichen sogar leicht gestiegen.
Wirtschaftlichkeit des Dieselmotors im Wandel
Der ADAC betont, dass sich die klassische Faustregel, wonach sich ein Diesel ab einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern jährlich rechnet, nicht mehr verallgemeinern lässt. Die tatsächliche Wirtschaftlichkeit hängt stark vom jeweiligen Modell und den individuellen Nutzungsmustern ab.
Für Verbraucher stellt der ADAC regelmäßig Vergleichsrechnungen zwischen Diesel- und Benzinmodellen bereit. Die Autokostendatenbank liefert detaillierte Informationen zu Anschaffungskosten, Kraftstoffverbrauch und Wartungsaufwand.
Auch wenn der Diesel durch den Skandal von 2015 einen erheblichen Imageverlust erlitten hat, sind die Umweltwerte aktueller Fahrzeuge deutlich besser als früher. Aufwändige Abgasnachbehandlungssysteme sorgen dafür, dass Schadstoffemissionen kaum noch messbar sind. Damit ist der Diesel aus ökologischer Sicht nicht schlechter einzustufen als andere Verbrenner.
Auswirkungen auf den Ersatzteilemarkt
Der Rückgang der Dieselmodelle wirkt sich direkt auf den Bedarf an Ersatzteilen aus. Komponenten wie Einspritzpumpen, Injektoren, Turbolader oder Partikelfilter verlieren an Relevanz, da die Neuzulassungen mit diesem Antrieb sinken. Werkstätten und Großhändler müssen sich darauf einstellen, dass die Nachfrage nach spezifischen Dieselteilen mittelfristig abnimmt. Gleichzeitig bleibt der Bestand an älteren Fahrzeugen noch über Jahre hinweg ein wichtiges Geschäftsfeld, was eine parallele Versorgung mit Ersatzteilen erforderlich macht.
Für Werkstätten bringt der Strukturwandel Chancen und Herausforderungen. Während Diesel-spezifische Reparaturen wie die Instandsetzung von Abgasrückführungssystemen oder die Reinigung von DPF-Filtern langfristig zurückgehen werden, gewinnt die Betreuung von Benzin- und Hybridfahrzeugen an Bedeutung. Der Wissenstransfer ist entscheidend: Nur Werkstätten, die sich frühzeitig auf alternative Antriebe einstellen, können den veränderten Kundenanforderungen gerecht werden.
Rolle der Gesetzgebung und Regulierung
Ein wesentlicher Treiber des Dieselrückgangs sind verschärfte Emissionsnormen und politische Vorgaben. Die Einführung von Euro-6-Normen sowie drohende Fahrverbote in Innenstädten haben die Attraktivität von Dieselfahrzeugen verringert. Hersteller reagieren darauf mit einer Umstellung ihrer Modellpalette, um Flottenziele hinsichtlich CO₂-Emissionen einzuhalten. Der Diesel bleibt zwar im Angebot, ist jedoch nicht mehr der zentrale Bestandteil der Verkaufsstrategie.
Langfristig wird der Diesel vor allem in Fahrzeugklassen bestehen, in denen Effizienz und Drehmoment Vorteile bringen – etwa bei Transportern, leichten Nutzfahrzeugen und größeren SUVs. In diesen Segmenten kann der Selbstzünder seine Stärken weiterhin ausspielen. Gleichzeitig verstärken Hersteller ihre Investitionen in Hybrid- und Elektroantriebe. Für den Diesel bedeutet das eine zunehmend spezialisierte Rolle: weg vom Massenmarkt hin zu Nischenanwendungen, in denen er technisch sinnvoll bleibt.
Fazit
Das Angebot an Dieselfahrzeugen hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verringert. Besonders Klein- und Mittelklassemodelle verschwinden zunehmend vom Markt. Während sich der Diesel in schweren Fahrzeugen und Kleinbussen behaupten kann, verliert er in den traditionellen Segmenten an Relevanz. Für die Werkstätten und den Teilehandel bedeutet dies eine Anpassung an veränderte Kundenbedürfnisse. Künftig wird die Wirtschaftlichkeit stärker vom Einzelfall abhängen, während technologische Entwicklungen den Diesel auf einem moderaten Niveau im Markt halten. Quelle: ADAC