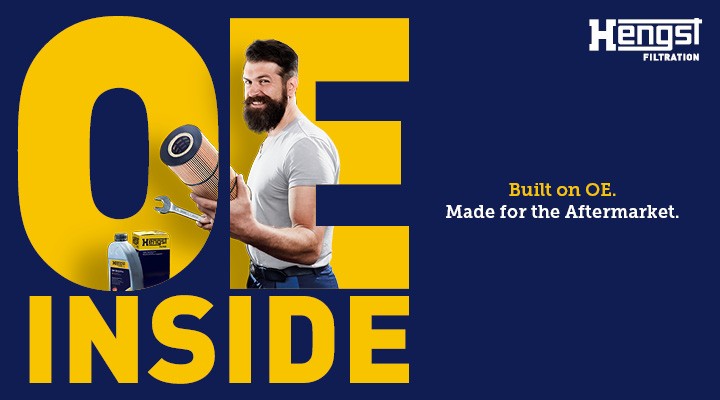Die neue Allensbach-Studie verdeutlicht, dass die individuelle Mobilität mit dem Auto in Deutschland unverändert eine zentrale Rolle spielt. Besonders im ländlichen Raum ist der Pkw für die Mehrheit der Bevölkerung unverzichtbar. Parallel dazu zeigt die Untersuchung deutliche Defizite bei der Verkehrsinfrastruktur und große Skepsis gegenüber der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht hier dringenden Handlungsbedarf, um Mobilität zukunftssicher zu gestalten.
Auto bleibt entscheidender Faktor für Mobilität
Drei von vier Bundesbürgern betrachten das Auto als unverzichtbar, in ländlichen Regionen sind es sogar neun von zehn. Damit hat die Bedeutung des Pkw im ländlichen Raum seit 2023 nochmals deutlich zugenommen. Unabhängigkeit, Flexibilität und Zeitersparnis sind die Hauptgründe für die hohe Bindung an das Auto. 78 Prozent sind überzeugt, dass kein anderes Verkehrsmittel dieselbe Freiheit ermöglicht.
Die Studie zeigt zudem, dass viele Menschen ihr Mobilitätsverhalten nur schwer ändern könnten. Auf dem Land halten 82 Prozent eine Veränderung für kaum möglich. Auch in Großstädten teilt eine Mehrheit diese Einschätzung, wenn auch auf niedrigerem Niveau. Damit bleibt das Auto das wichtigste Verkehrsmittel für alltägliche Erreichbarkeit und gesellschaftliche Teilhabe.
Ein zentrales Ergebnis betrifft die Bewertung der Verkehrsinfrastruktur. 77 Prozent der Befragten beurteilen den Zustand von Straßen und Brücken in Deutschland als schlecht oder sehr schlecht. Besonders in Ostdeutschland und im ländlichen Raum ist die Zufriedenheit seit 2021 stark gesunken. Laut VDA besteht dringender Investitionsbedarf, um die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu sichern.
Während in Großstädten mehr Menschen mit dem ÖPNV-Angebot zufrieden sind, herrscht in ländlichen Regionen große Unzufriedenheit. In Dörfern äußern 58 Prozent Kritik am öffentlichen Nahverkehr, während in Städten mehr als die Hälfte zufrieden ist. Diese Unterschiede verdeutlichen die unterschiedlichen Mobilitätsrealitäten zwischen Stadt und Land.
E-Mobilität: Skepsis bleibt, Akzeptanz wächst langsam
Bei der Kaufabsicht zeigt sich ein begrenztes Interesse an Elektroautos. Nur 11 Prozent der Befragten planen, in den kommenden Jahren ein E-Auto anzuschaffen. Benziner und Diesel bleiben deutlich beliebter. Das allgemeine Potenzial liegt bei 22 Prozent, vor allem jüngere Menschen und einkommensstärkere Gruppen zeigen sich aufgeschlossener.
Als Kaufargumente werden vor allem geringere Steuern, Beitrag zum Klimaschutz, gestiegene Reichweiten und niedrigere Betriebskosten genannt. Unsicherheit besteht jedoch weiterhin bei den tatsächlichen Kosten im Vergleich zum Verbrenner.
Die Bewertung der Ladeinfrastruktur fällt weiterhin kritisch aus. Nur 22 Prozent halten das Angebot an öffentlichen Ladepunkten in Wohnortnähe für gut, auch wenn sich dieser Wert seit 2021 mehr als verdoppelt hat. Besonders Autobahnen und Landstraßen schneiden schlecht ab.
Interessant ist der Unterschied zwischen E-Auto-Besitzenden und der Gesamtbevölkerung: Während rund drei Viertel der E-Auto-Fahrenden das Angebot positiv bewerten, überwiegt in der Gesamtbevölkerung die Skepsis. Praktische Erfahrungen scheinen also die Wahrnehmung zu verbessern.
Unterschiede zwischen Stadt und Land als zentrale Herausforderung
Die Ergebnisse der Studie verdeutlichen, wie stark sich die Mobilitätsrealitäten zwischen Stadt und Land unterscheiden. Während in Großstädten Alternativen wie ÖPNV oder Carsharing präsenter sind, bleibt das Auto auf dem Land alternativlos. Diese Diskrepanz stellt Politik und Wirtschaft vor die Aufgabe, regionale Unterschiede stärker zu berücksichtigen. Eine einheitliche Strategie für ganz Deutschland greift zu kurz, vielmehr braucht es Lösungen, die den jeweiligen Strukturen und Bedürfnissen gerecht werden.
Für Kfz-Werkstätten und den Großhandel im Bereich Ersatzteile bestätigen die Zahlen den weiterhin hohen Stellenwert des klassischen Pkw. Auch wenn E-Mobilität wächst, bleibt der Verbrenner für die breite Masse relevant. Das sichert die Nachfrage nach Ersatzteilen, Wartung und Serviceleistungen für Benziner und Diesel. Gleichzeitig wird der steigende Anteil an Hybrid- und Elektrofahrzeugen neue Kompetenzfelder eröffnen, etwa im Bereich Hochvolttechnik oder Ladeinfrastruktur-Wartung. Werkstätten sind daher gefordert, das bestehende Geschäft zu sichern und parallel Know-how für die kommenden Technologien aufzubauen.
Ladeinfrastruktur als Treiber oder Hemmnis
Der Erfolg der Elektromobilität hängt maßgeblich von der Ladeinfrastruktur ab. Solange ein Großteil der Bevölkerung das Angebot als unzureichend empfindet, bleibt die Kaufbereitschaft begrenzt. Für die Praxis bedeutet das, dass Investitionen in Schnellladepunkte und ein flächendeckendes Netz von Ladeplätzen entscheidend sind. Werkstätten könnten dabei eine Rolle übernehmen, indem sie Ladepunkte an ihren Standorten integrieren und so zusätzliche Kundenzugänge schaffen. Diese Verbindung aus Service und Infrastruktur bietet Chancen für neue Geschäftsmodelle.
Die Transformation hin zu klimaneutraler Mobilität ist nicht nur eine technologische Frage, sondern auch ein gesellschaftlicher Prozess. Die Allensbach-Ergebnisse zeigen, dass Akzeptanz nur dann entsteht, wenn Alltagstauglichkeit gesichert ist. Dazu gehören verlässliche Straßen, ein funktionierender ÖPNV, digitale Vernetzung und ein dichtes Netz an Ladepunkten. Für die Automobilwirtschaft, den Teilehandel und die Werkstätten bedeutet dies, dass bestehende Geschäftsmodelle weitergeführt, aber gleichzeitig zukunftsfähig ergänzt werden müssen. Innovation, Serviceorientierung und Investitionen in neue Technologien bleiben die zentralen Erfolgsfaktoren.
Fazit
Die Allensbach-Studie macht deutlich, dass das Auto auch in Zukunft für die Mehrheit der Bevölkerung unverzichtbar bleibt. Gleichzeitig offenbaren die Ergebnisse große Herausforderungen: eine unzureichende Verkehrsinfrastruktur, Skepsis gegenüber der E-Mobilität und große Unterschiede zwischen Stadt und Land.
Für eine erfolgreiche Transformation zur klimaneutralen Mobilität sind Investitionen in Straßen, Brücken und Ladeinfrastruktur ebenso notwendig wie verlässliche politische Rahmenbedingungen. Nur so lässt sich das Vertrauen der Bevölkerung sichern und die Mobilität in Deutschland nachhaltig gestalten. Quelle: VDA