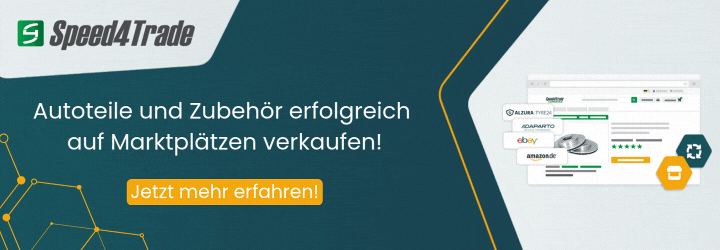Die Traktionsbatterie zählt zu den kostenintensivsten Bauteilen eines batterieelektrischen Fahrzeugs (BEV). Ihr Zustand beeinflusst nicht nur Reichweite und Fahrverhalten, sondern ist auch für den Wiederverkaufswert eines E-Autos entscheidend. Fachleute beobachten: Moderne Akkus zeigen sich robuster als erwartet. Die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH hat gemeinsam mit dem Diagnosespezialisten AVILOO eine Reihe von Maßnahmen veröffentlicht, die im Alltag helfen, die Batterie zu schonen und ihren Zustand zuverlässig zu bewerten.
Ladebereiche sinnvoll nutzen
Im täglichen Fahrbetrieb empfiehlt es sich, den Ladezustand der Batterie möglichst zwischen 20 und 80 Prozent zu halten. In diesem Bereich laufen die elektrochemischen Prozesse in den Zellen besonders stabil. Wird dauerhaft bis zur Vollladung oder in den unteren einstelligen Prozentbereich geladen, steigt die Belastung des Materials. Viele Fahrzeuge regulieren die Ladeleistung automatisch bei hohen oder sehr niedrigen Füllständen – das dient der Schonung der Batterie.
Um die Kontrolle über die Batterieladung zu behalten, müssen Fahrer nicht ständig am Ladekabel stehen. In den Fahrzeugeinstellungen oder über verbundene Apps lässt sich meist festlegen, bis zu welchem Ladegrad Strom aufgenommen werden soll. Die Technik unterbricht den Ladevorgang anschließend selbstständig – das reduziert den Stress für die Zellen und vereinfacht das Handling.
Wer auf längeren Strecken unterwegs ist oder vorab genau weiß, dass eine hohe Reichweite benötigt wird, kann selbstverständlich auch auf die volle Speicherkapazität zugreifen. Für einen effizienten Betrieb unter extremen Witterungsbedingungen – etwa im Winter oder Hochsommer – lohnt sich das sogenannte Vorkonditionieren: Dabei werden Fahrzeuginnenraum und Batterie während des Ladens klimatisiert. Das senkt den Energieverbrauch beim Start und schützt die Technik.
Gleichstrom nur punktuell einsetzen
Schnellladesysteme mit Gleichstrom (DC) sind bei Zeitdruck nützlich – erzeugen aber auch hohe thermische Lasten in der Batterie. Wer regelmäßig zu Hause oder an der Arbeitsstelle lädt, sollte dort auf Wechselstrom (AC) setzen. Die moderaten Ladeleistungen über AC-Wallboxen oder öffentliche AC-Ladesäulen schonen die Zellchemie langfristig. Dennoch gilt: Auch bei Schnellladung regelt die Fahrzeugelektronik die Stromzufuhr automatisch, sobald kritische Temperaturen erreicht werden.
Beim Verzögern oder Bremsen kann ein Elektrofahrzeug Bremsenergie zurückgewinnen. Diese sogenannte Rekuperation speist die dabei erzeugte elektrische Energie in den Akku zurück. Das steigert die Reichweite besonders im Stop-and-Go-Verkehr. Zwar handelt es sich um zusätzliche Ladezyklen, doch die Belastung ist minimal im Vergleich zum Nutzen. In urbanen Fahrprofilen lassen sich so teils über 30 Prozent der Energie wieder einspeisen.
Akkus zeigen sich langlebiger als vermutet
Früher galten Traktionsbatterien als kritischer Punkt bei der Bewertung von gebrauchten E-Fahrzeugen. Inzwischen zeigt sich: Viele Akkus erreichen auch nach 200.000 Kilometern noch rund 90 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität. Das erhöht nicht nur das Vertrauen in die Technik, sondern verbessert auch die Restwertkalkulation. Um den tatsächlichen Zustand eines Hochvoltspeichers transparent zu erfassen, bietet die GTÜ gemeinsam mit dem Diagnosespezialisten AVILOO einen zertifizierten Batterietest an. Die Analyse erfolgt fahrzeugunabhängig und liefert objektive Daten zur Akkugesundheit – ein Vorteil beim Verkauf oder bei der Bewertung von Leasingrückläufern.
Elektroautos, die über Tage oder Wochen hinweg nicht genutzt werden, sollten mit einem Ladezustand zwischen 50 und 70 Prozent geparkt werden. Eine vollständige Ladung über längere Zeit oder ein vollständig entladener Akku erhöht das Risiko für Zellschäden. Gerade im Werkstattbetrieb oder bei saisonal genutzten Fahrzeugen lohnt sich ein Blick auf den Ladezustand vor der Standzeit.
Temperatur als entscheidender Faktor für die Akkuleistung
Die Außentemperatur hat direkten Einfluss auf das Ladeverhalten und die Leistungsfähigkeit von Lithium-Ionen-Batterien. Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Beweglichkeit der Ionen im Elektrolyten, was zu einer reduzierten Lade- und Entladeleistung führt. Gleichzeitig erhöht sich der Innenwiderstand der Zellen. Im Sommer dagegen kann die thermische Belastung bei hohen Umgebungstemperaturen die Zellalterung beschleunigen. Viele Fahrzeuge verfügen über ein aktives Thermomanagementsystem, das den Akku temperiert. Werkstätten sollten bei Diagnosen rund um das Hochvoltsystem daher auch Umweltdaten berücksichtigen – insbesondere bei Fehlermeldungen zur Ladeleistung oder bei reduzierter Reichweite.
Die Traktionsbatterie eines E-Fahrzeugs besteht aus mehreren hundert bis tausend Einzelzellen, die zu Modulen zusammengeschaltet sind. Damit das Gesamtsystem zuverlässig funktioniert, müssen diese Zellen möglichst gleichmäßig geladen und entladen werden. Unausgeglichene Zellspannungen führen zu Kapazitätsverlust und können das Batteriemanagementsystem (BMS) in den Schutzmodus versetzen. Die Zellbalancierung erfolgt meist automatisch während oder nach dem Ladevorgang. Eine unregelmäßige oder unvollständige Balancierung kann in der Werkstatt auf fehlerhafte Module oder defekte Sensorik hinweisen und sollte weitergehend geprüft werden.
Fazit
Wer sein Elektrofahrzeug effizient nutzen und gleichzeitig den Akku bestmöglich erhalten will, kann mit wenigen Maßnahmen viel erreichen. Die wichtigsten Faktoren: Ladeverhalten anpassen, Gleichstrom gezielt einsetzen, Rekuperation nutzen und bei Bedarf den Batteriezustand professionell prüfen lassen. So bleiben Reichweite und Leistungsfähigkeit langfristig auf einem stabilen Niveau – und das E-Fahrzeug behält seinen Wert. Quelle: GTÜ