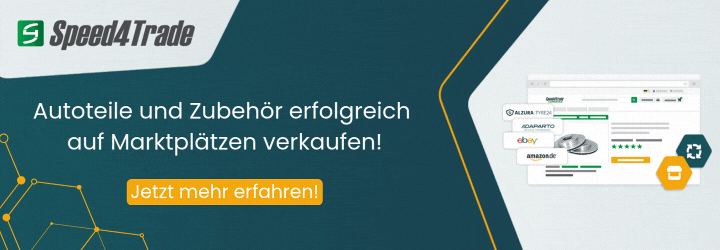Mit Inkrafttreten der StVFernLV am 1. Dezember 2025 wird das teleoperierte Fahren auf öffentlichen Straßen erstmals rechtlich zugelassen. Die vom BMV initiierte Verordnung schafft einen verbindlichen Rahmen für die Erprobung ferngesteuerter Fahrzeuge, bei denen die Steuerung nicht im Fahrzeug, sondern aus einem externen Leitstand erfolgt. Der Fokus liegt auf Sicherheit, technischer Machbarkeit und einer fünfjährigen Testphase zur Vorbereitung dauerhafter Regelungen.
Klare Spielregeln für ferngelenkten Fahrbetrieb
Mit der Einführung der Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung reagiert der Gesetzgeber auf die technologische Entwicklung im Bereich der Fahrzeugautomatisierung. Teleoperation, also das Fernlenken eines Fahrzeugs durch eine Person außerhalb des Fahrzeugs, wird dabei nicht nur als Brückentechnologie, sondern auch als eigenständige Betriebsform betrachtet.
Zentraler Bestandteil der Verordnung ist die Erprobungsphase: Für die kommenden fünf Jahre dürfen ferngelenkte Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden – jedoch unter strengen Voraussetzungen. Ziel ist es, Erfahrungen zu sammeln, den Betrieb sicher zu gestalten und bestehende Mobilitätsangebote sinnvoll zu ergänzen.
Gerade im urbanen Umfeld bietet Teleoperation neue Möglichkeiten. Im Carsharing-Segment könnten Fahrzeuge künftig automatisiert zur nächsten Nutzungseinheit fahren, ohne dass eine Person physisch anwesend ist. Der Fahrzeugwechsel würde damit beschleunigt, Leerfahrten könnten reduziert werden.
Auch der Einsatz ferngelenkter Taxis ist ein denkbares Szenario. Fahrzeuge könnten bedarfsgerecht eingesetzt werden, was insbesondere in Regionen mit geringer Nachfrage oder zu verkehrsarmen Zeiten von Vorteil wäre. Die Verfügbarkeit würde erhöht, während der Personaleinsatz minimiert wird.
Relevanz für Logistik, ÖPNV und Kommunalflotten
Neben dem Personenverkehr ergeben sich auch im Bereich der Logistik klare Effizienzvorteile. Gütertransporte könnten mit minimalem Personaleinsatz flexibler gesteuert werden. Besonders bei Fahrten auf dem Betriebshof, bei der letzten Meile oder auf definierten Strecken innerhalb geschlossener Systeme kann Teleoperation wirtschaftlich attraktiv sein.
Auch kommunale Anwendungen, etwa im öffentlichen Nahverkehr, bei Müllsammelfahrzeugen oder bei Versorgungsfahrten, können von ferngesteuerten Konzepten profitieren. Gerade dort, wo der Fachkräftemangel den Betrieb erschwert, eröffnet Teleoperation neue Wege zur Aufrechterhaltung und Optimierung kommunaler Dienstleistungen.
Ein weiterer Aspekt der Verordnung betrifft den Regelbetrieb autonomer Fahrzeuge. Teleoperation kann dabei als Rückfallebene dienen: In komplexen Situationen übernimmt eine fernsteuernde Person temporär die Kontrolle. Diese Ergänzung erhöht die Sicherheit und macht autonome Systeme praxistauglicher – besonders in Mischverkehrssituationen oder bei unklaren Verkehrszeichen.
Die StVFernLV bildet somit nicht nur die Grundlage für ferngesteuertes Fahren, sondern auch eine Schnittstelle zur Weiterentwicklung autonomer Fahrzeugtechnologien.
Technische Voraussetzungen für den Betrieb ferngelenkter Fahrzeuge
Der sichere Betrieb ferngelenkter Fahrzeuge setzt eine stabile und latenzarme Datenverbindung voraus. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Mobilfunkstandard 5G, der sowohl die notwendige Bandbreite als auch die Echtzeitübertragung von Videodaten, Steuerimpulsen und Rückmeldesignalen ermöglicht. Zusätzlich müssen Fahrzeuge mit redundanten Steuer- und Bremssystemen ausgestattet sein, um auch im Fall technischer Störungen die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Kamerasysteme, Lidar-Sensoren und Rückmeldeeinheiten liefern dem Leitstand alle notwendigen Informationen über die Fahrzeugumgebung. Über das zentrale Interface im Leitstand erfolgt die Fahrzeugsteuerung, wobei die Kommunikation durch verschlüsselte Verbindungen abgesichert ist. Hierbei gelten höchste Anforderungen an IT-Sicherheit und Ausfallschutz.
Mit der StVFernLV wird auch ein klarer Rahmen für die Qualifikation von fernsteuerndem Personal geschaffen. Anders als bei klassischem Fahrpersonal erfolgt die Steuerung nicht im Fahrzeug selbst, sondern von einem stationären Leitstand aus – vergleichbar mit dem Arbeitsplatz eines Fluglotsen. Die Anforderungen an Reaktionsgeschwindigkeit, Aufmerksamkeit und räumliches Vorstellungsvermögen sind hoch.
Der Leitstand muss ergonomisch gestaltet, mit mehreren Bildschirmen ausgestattet und technisch in der Lage sein, mehrere Fahrzeuge gleichzeitig zu überwachen oder bei Bedarf zu übernehmen. Auch rechtlich ergeben sich neue Anforderungen: Der Leitstandbetreiber trägt die Verantwortung für den sicheren Betrieb und muss über entsprechende Zulassungen und Nachweise verfügen. Die Verordnung definiert hier erstmals verbindliche Standards.
Wirtschaftliche Chancen für Industrie und Handwerk
Mit der Schaffung eines rechtlichen Rahmens für Teleoperation eröffnen sich neue Geschäftsfelder – insbesondere für Fahrzeughersteller, Systemlieferanten und Dienstleister im Bereich Flottenmanagement. Werkstätten und Fahrzeugumrüster könnten zukünftig eine zentrale Rolle bei der Integration der erforderlichen Hardware und Softwarelösungen spielen.
Gerade im Nutzfahrzeugbereich bieten sich Potenziale: Bestandsfahrzeuge lassen sich mit entsprechenden Systemen nachrüsten, was vornehmlich für Betriebe im Logistik- und Transportsektor interessant ist. Für den Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen ergeben sich ebenfalls neue Produktsegmente – etwa spezielle Steuergeräte, Kameramodule oder Schnittstellenlösungen, die für die Nachrüstung benötigt werden.
Die StVFernLV ist ein nationaler Vorstoß, steht aber nicht isoliert: In mehreren europäischen Ländern werden derzeit ähnliche Regulierungsansätze entwickelt. Eine langfristige Harmonisierung der Standards auf EU-Ebene wird entscheidend sein, um grenzüberschreitenden Einsatz und Kompatibilität zu ermöglichen.
Die deutsche Verordnung könnte dabei als Blaupause für andere Mitgliedsstaaten dienen. Auch die Vereinten Nationen beschäftigen sich im Rahmen der UNECE mit der Regulierung automatisierter und ferngesteuerter Fahrzeuge. Eine frühzeitige Ausrichtung an internationalen Standards kann deutschen Anbietern Wettbewerbsvorteile sichern und die Exportchancen für entsprechende Technologien erhöhen.
Fazit
Mit der neuen Verordnung schafft der Gesetzgeber nicht nur Rechtssicherheit, sondern fördert auch die Entwicklung innovativer Verkehrskonzepte. Ob im Carsharing, in der Logistik oder im ÖPNV – teleoperiertes Fahren könnte die Effizienz steigern und gleichzeitig bestehende Systeme entlasten. In den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie sich die Technologie in der Praxis bewährt. Der Startschuss ist gefallen – und die Weichen sind gestellt. Quelle: BMV