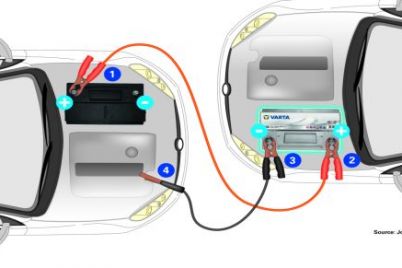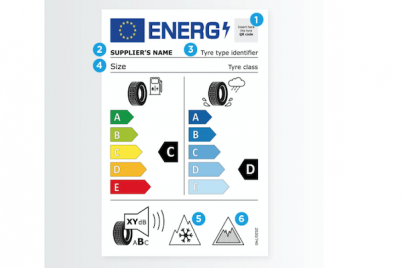Das Projekt „KelRide“ ist ein bedeutendes Vorhaben im Bereich der autonomen Mobilität, bei dem TÜV Rheinland eine zentrale Rolle spielt. Im niederbayerischen Landkreis Kelheim entsteht das größte zusammenhängende Betriebsgebiet Europas für hoch automatisierte Shuttles. Diese Fahrzeuge, ausgestattet mit neuesten Sensortechnologien und Softwarelösungen, operieren als On-Demand-Dienst und setzen neue Maßstäbe für den autonomen Verkehr im öffentlichen Raum. Der Artikel beleuchtet die technischen Fortschritte, die Herausforderungen und die Rolle von TÜV Rheinland bei der Validierung und Zulassung dieser innovativen Mobilitätslösung.
- Projekt KelRide: Europas größtes Netz für autonome Shuttles
- Flexibler On-Demand-Dienst im ländlichen Raum
- Verbesserte Allwetterfähigkeit durch neue Technologien
- Validierungsprozess und Testverfahren von TÜV Rheinland
- Zukunftsperspektiven und Vision Zero
Projekt KelRide: Europas größtes Netz für autonome Shuttles
Seit Anfang 2024 fahren im Landkreis Kelheim fünf hoch automatisierte Shuttles des Technologieunternehmens EasyMile auf einem 30 km umfassenden Straßennetz. Dies stellt das größte zusammenhängende Betriebsgebiet für autonome Shuttles in Europa dar. Das Projekt „KelRide“ wird von einem Konsortium getragen, zu dem unter anderem EasyMile, Via, die P3 Group, der Landkreis Kelheim und die Technische Universität Berlin gehören. Ziel ist es, die Einsatzmöglichkeiten hoch automatisierter Shuttles im öffentlichen Straßenverkehr zu erproben und weiterzuentwickeln.
Flexibler On-Demand-Dienst im ländlichen Raum
Im Gegensatz zu herkömmlichen öffentlichen Verkehrsmitteln operieren die KelRide-Shuttles als flexibler On-Demand-Dienst. Fahrgäste können über „KEXI“ (Kelheim Express Individuell) Fahrten buchen, wodurch die Fahrzeuge in Echtzeit dynamisch geroutet werden. Dieses System bietet den Vorteil, dass die Shuttles genau dann zur Verfügung stehen, wenn sie benötigt werden, und somit eine nahtlose Anbindung an den ÖPNV ermöglichen. Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing betont die Bedeutung dieses Projekts für die Zukunft der Mobilität im ländlichen Raum.
Verbesserte Allwetterfähigkeit durch neue Technologien
Eine der größten Herausforderungen für autonome Fahrzeuge sind ungünstige Wetterbedingungen. Das Projekt „KelRide“ hat erfolgreich neue Sensortechnologien und adaptive Softwarelösungen integriert, um die Allwetterfähigkeit der Shuttles zu verbessern. Diese Technologien erhöhen die Verfügbarkeit des Dienstes auch bei schwierigen Wetterverhältnissen wie starkem Schneefall, Regen oder Nebel. TÜV Rheinland spielte eine entscheidende Rolle bei der Validierung dieser Technologien auf dem Proving Ground ZalaZONE, einem hochmodernen Testgelände in Ungarn.
Validierungsprozess und Testverfahren von TÜV Rheinland
TÜV Rheinland bringt seine langjährige Erfahrung mit hoch automatisierten und vernetzten Systemen in das Projekt ein. Auf dem 265 Hektar großen Testgelände ZalaZONE wurden umfangreiche Tests durchgeführt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der neuen Technologien zu gewährleisten. TÜV Rheinland hat alle für die Straßenzulassung erforderlichen Prüfungen und Risikoanalysen durchgeführt und die Kommunikation mit den Zulassungsbehörden unterstützt. Dabei wurde ein breites Spektrum an Fahrszenarien und Umgebungsbedingungen berücksichtigt, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Zukunftsperspektiven und Vision Zero
Das Projekt „KelRide“ ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu sicherer und nachhaltiger Mobilität. Die regelmäßige Überprüfung und Wartung der autonomen Systeme ist entscheidend, um die Ziele der „Vision Zero“ – null Verkehrstote und Schwerverletzte – zu erreichen. Dr.-Ing. Michael Fübi, Vorstandsvorsitzender der TÜV Rheinland AG, betont die Bedeutung der Einbindung von KI-Anwendungen und hoch automatisierten Systemen in solche zukunftsweisenden Projekte. Die gewonnenen Erkenntnisse und Technologien können zukünftig auf weitere Fahrzeuggruppen und Einsatzgebiete übertragen werden.
Fazit zum Projekt KelRide
Das Projekt „KelRide“ zeigt eindrucksvoll, wie autonome Shuttles im ländlichen Raum eingesetzt werden können, um den öffentlichen Nahverkehr zu verbessern und die Umwelt zu schonen. Die enge Zusammenarbeit von TÜV Rheinland mit anderen Konsortialpartnern und die erfolgreiche Integration neuer Technologien setzen neue Maßstäbe für den Betrieb hoch automatisierter Fahrzeuge. Mit der Ausweitung solcher Projekte und kontinuierlicher technischer Weiterentwicklung kann die Vision einer sicheren und umweltfreundlichen Mobilität Realität werden.