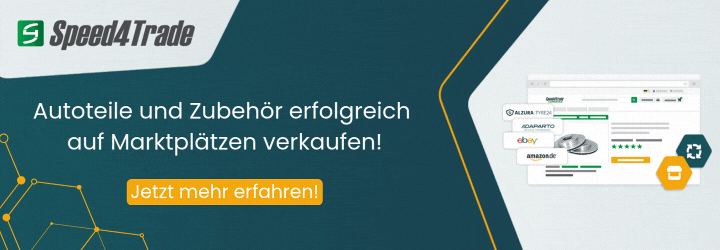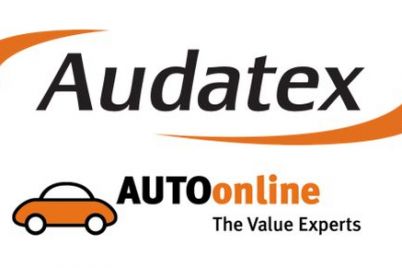Die Fortsetzung des strategischen Dialogs auf EU-Ebene markiert einen wichtigen Schritt in der Debatte um die Zukunft der europäischen Automobilindustrie. Mit dem Engagement von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für eine realistische Betrachtung der CO₂-Ziele wächst die Hoffnung auf mehr Pragmatismus in der Regulierung. Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) sieht die Diskussion als längst überfällig und fordert eine zügige Flexibilisierung der Flottengrenzwerte, um die Transformation hin zur Elektromobilität nicht zu gefährden.
Flexibilisierung als Schlüssel zur Planungssicherheit
Die bestehenden CO₂-Flottengrenzwerte setzen Fahrzeughersteller unter erheblichen Druck. Zwar haben viele Hersteller den Hochlauf der Elektromobilität entschlossen vorangetrieben, doch die Rahmenbedingungen in Europa bleiben unzureichend. Vor allem der schleppende Ausbau der Ladeinfrastruktur und hohe Stromkosten bremsen die Nachfrage nach E-Autos. VDIK-Präsidentin Imelda Labbé betont daher, dass die Ziele nur erreicht werden können, wenn die regulatorischen Vorgaben an die tatsächliche Marktentwicklung angepasst werden. Eine Flexibilisierung der Grenzwerte sei unverzichtbar, bis die strukturellen Voraussetzungen geschaffen sind.
Besonders im Kleinwagensegment zeigt sich der Spagat zwischen politischem Anspruch und wirtschaftlicher Realität. Fahrzeuge wie der Renault Twingo E-Tech, der Skoda Citigo-e, der Cupra Raval oder der Hyundai i10 Electric verdeutlichen, dass Hersteller mit großem Engagement an bezahlbaren Modellen arbeiten. Doch die Kostenstruktur bleibt angespannt: Batterien, Rohstoffe und Produktionsaufwand treiben die Preise nach oben. Laut dem CAR-Institut beträgt die Preisdifferenz zwischen Elektrofahrzeugen und vergleichbaren Verbrennern im Durchschnitt weniger als 3.000 Euro – ein Fortschritt, der jedoch auf hohen Rabatten basiert. Diese Preisnachlässe dienen vor allem dazu, die CO₂-Flottengrenzwerte zu erfüllen.
Politische Unterstützung dringend erforderlich
Die Hersteller investieren massiv in neue Fahrzeugplattformen, Batterietechnologien und Fertigungskapazitäten. Doch ohne politische Rückendeckung droht der Fortschritt ins Stocken zu geraten. Der VDIK fordert, dass die Europäische Kommission die geplanten Review-Prozesse beschleunigt und einen neuen Zeitplan für die CO₂-Grenzwerte vorlegt. Nur eine realistische Anpassung an die wirtschaftlichen und infrastrukturellen Gegebenheiten kann verhindern, dass die Branche an regulatorischen Zielkonflikten scheitert. Zudem würde eine solche Entscheidung das Vertrauen der Verbraucher stärken, die sich derzeit vielfach verunsichert zeigen.
Mit dem strategischen Dialog setzt die EU-Kommission ein wichtiges Signal. Das Ziel, kleinere und erschwingliche Elektrofahrzeuge stärker zu fördern, weist in die richtige Richtung. Der VDIK sieht darin einen entscheidenden Schritt, um die Elektromobilität für breite Kundengruppen zugänglich zu machen. Nun liegt es an der Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen – mit realistischen Zielvorgaben, klaren Übergangsfristen und einer abgestimmten Infrastrukturstrategie. Nur dann kann Europa den Wandel der Automobilindustrie erfolgreich gestalten und gleichzeitig Wettbewerbsfähigkeit sowie Klimaziele in Einklang bringen.
Industriepolitische Verantwortung und Standortfragen
Die europäische Automobilindustrie steht vor einem doppelten Transformationsdruck: Sie muss einerseits CO₂-neutral werden, andererseits ihre Produktionsbasis in Europa sichern. Viele internationale Hersteller sehen in der derzeitigen Regulierung eine Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Standorte. Strenge Flottengrenzwerte ohne ausreichende Flexibilisierung könnten dazu führen, dass Investitionen in Produktion und Entwicklung in außereuropäische Märkte verlagert werden. Der VDIK warnt daher vor einem regulatorischen Übersteuern, das Arbeitsplätze und Wertschöpfung in Europa gefährdet.
Die Elektrifizierung des Fahrzeugbestands ist ein langfristiger Prozess. Hybride Antriebe, hocheffiziente Verbrennungsmotoren und alternative Kraftstoffe leisten bereits heute einen Beitrag zur CO₂-Reduktion. Eine Regulierung, die ausschließlich batterieelektrische Fahrzeuge begünstigt, greift daher zu kurz. Der VDIK plädiert dafür, auch Übergangstechnologien in die CO₂-Bilanz einzubeziehen. So können Hersteller flexibel auf die Nachfrage reagieren, während die Ladeinfrastruktur und Energieversorgung weiter ausgebaut werden. Eine solche Technologieoffenheit ist entscheidend, um die Klimaziele erreichbar und wirtschaftlich tragfähig zu gestalten.
Fazit
Die Flexibilisierung der Flottengrenzwerte ist kein Rückschritt, sondern eine notwendige Anpassung an die Realität des Marktes. Der VDIK fordert die Europäische Kommission auf, jetzt zu handeln und Planungssicherheit für Hersteller, Handel und Verbraucher zu schaffen. Nur mit einer ausgewogenen CO₂-Regulierung kann der Hochlauf der Elektromobilität dauerhaft gelingen. Quelle: VDIK