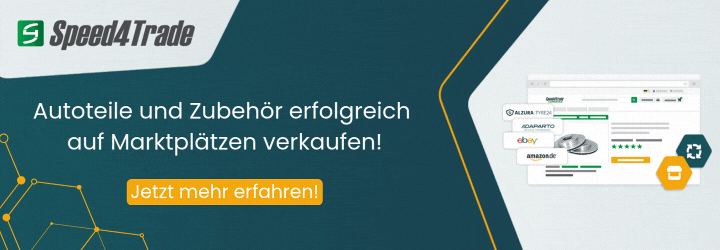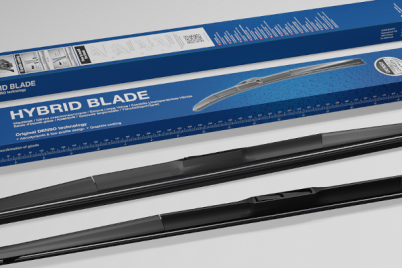Wird diese Scheibe nach Steinschlag oder Bruch ersetzt, verliert das System ohne präzise Nachkalibrierung seine Genauigkeit. Schon Abweichungen im Millimeterbereich können die Funktion von Spurhalteassistent oder Notbremsassistent beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zu Fehlfunktionen führen.
Relevanz für den Werkstattalltag
Für Werkstätten bedeutet der Scheibentausch längst nicht mehr nur eine Glasreparatur, sondern eine sicherheitsrelevante Arbeit. Branchenuntersuchungen zeigen, dass eine nicht kalibrierte Kamera das Sichtfeld um mehrere Grad verschieben kann. In der Praxis kann dies bedeuten, dass ein Fahrzeug eine Gefahr auf der Fahrbahn zu spät erkennt oder unberechtigt eingreift.
Eine spezialisierte Autoglas Werkstatt verfügt über die notwendige Messtechnik, um Sensoren nach dem Einbau korrekt zu justieren. Standardisierte Verfahren, die von Fahrzeugherstellern vorgegeben sind, erfordern dabei moderne Kalibriergeräte, die optische und digitale Methoden kombinieren. Nur so ist gewährleistet, dass die Systeme die ursprüngliche Genauigkeit wieder erreichen.
Technische Anforderungen und Investitionen
Die Anforderungen an Werkstätten steigen mit jedem Modelljahr. Neben Kameras für Spurhalteassistenten müssen zunehmend auch Radar- und Lidar-Sensoren berücksichtigt werden. Diese Systeme benötigen unterschiedliche Kalibrierverfahren, die nur mit einer entsprechend ausgerüsteten Werkstattumgebung umgesetzt werden können.
Investitionen in moderne Kalibriertechnik sind deshalb unvermeidbar. Laser- und kamerabasierte Messsysteme, kombiniert mit aktueller Software, ermöglichen eine Justierung nach Herstellervorgaben. Marktanalysen zeigen, dass Betriebe, die frühzeitig in solche Technik investieren, nicht nur ihre Servicequalität sichern, sondern auch zusätzliche Umsätze generieren.
Werkstätten stehen dabei nicht immer allein vor den Kosten. Industrie- und Handelskammern (IHK) beraten über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Hinzu kommen bundesweite Programme wie die Investitionsförderung des BAFA oder branchenspezifische Initiativen der Länder, die Anschaffungen energieeffizienter oder digitaler Technik unterstützen. Auch Leasingmodelle werden von Herstellern zunehmend so gestaltet, dass kleinere Betriebe Einstiegshürden leichter überwinden können.
Welche Unterstützung Betriebe nutzen können
- IHK-Beratung: Informationen zu regionalen und bundesweiten Förderprogrammen, individuelle Beratung zu Investitionsplänen
- BAFA-Förderungen: Zuschüsse für digitale und energieeffiziente Technologien, die auch Kalibrieranlagen umfassen können
- Landesprogramme: Unterschiedliche Fördertöpfe je nach Bundesland, oft mit Fokus auf Digitalisierung und Mittelstand
- Leasing- und Mietmodelle: Hersteller bieten flexible Finanzierungsoptionen, um Technik ohne hohe Anfangsinvestition nutzbar zu machen
- Kooperationen: Zusammenarbeit mit spezialisierten Dienstleistern, um Kalibrierungen zunächst extern abzuwickeln und Erfahrungen zu sammeln
Qualifikation und Dokumentation als zentrale Säulen
Moderne Technik allein reicht nicht aus. Fachkräfte müssen im Umgang mit Kalibriergeräten geschult sein und die Vorgaben der Fahrzeughersteller präzise umsetzen können. Herstellerhandbücher geben oft exakte Anweisungen, welche Kalibriermatten, Zieltafeln oder Softwareparameter einzusetzen sind. Schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass eine Kamera nur eingeschränkt arbeitet oder Radarstrahlen nicht korrekt reflektiert werden. Daher werden Mitarbeiterschulungen inzwischen zu einem festen Bestandteil des Werkstattbetriebs. Zulieferer, Verbände und unabhängige Akademien haben in den letzten drei Jahren ihr Angebot stark ausgeweitet, weil der Bedarf kontinuierlich steigt.
Ein weiterer Schwerpunkt ist die Dokumentation. Werkstätten, die jede Kalibrierung nachvollziehbar protokollieren, schaffen nicht nur Vertrauen beim Kunden, sondern sichern sich auch rechtlich ab. Dokumentierte Werte können im Falle von Haftungsfragen oder Streitfällen entscheidend sein. Digitale Systeme erlauben heute die automatische Speicherung von Messdaten, inklusive Zeitstempel, Fahrzeugidentnummer und Soll-Ist-Vergleich. Diese Datenbanken erleichtern zudem die interne Qualitätssicherung und können für externe Audits genutzt werden.
Ausblick auf die nächsten Jahre
Der Trend geht eindeutig in Richtung vollständiger Prozessdigitalisierung. Prognosen gehen davon aus, dass bis 2030 nahezu alle Kalibrierungen digital erfasst und über zentrale Plattformen an Hersteller oder Prüforganisationen übermittelt werden. Damit steigen die Anforderungen an Datensicherheit und Schnittstellenstandards. Parallel wird erwartet, dass Schulungen verpflichtender Teil der Zertifizierung werden. Schon heute fordern einige Hersteller den Nachweis regelmäßiger Trainings, damit Werkstätten weiterhin Zugriff auf technische Informationen haben.