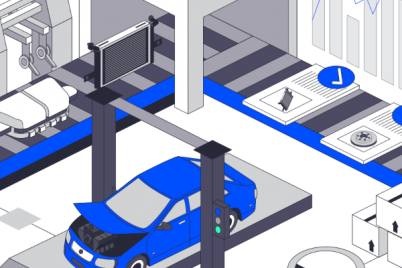Nach über 160.000 gefahrenen Kilometern und vier Jahren im Einsatz endet für den VW ID.3 im ADAC-Dauertest die Herstellergarantie auf die Hochvolt-Batterie. Die Prüfung des Fahrzeugs kommt zur rechten Zeit – und sie liefert überraschend positive Erkenntnisse. Trotz intensiver Nutzung im Alltag, häufigen Schnellladens und regelmäßiger 100-Prozent-Ladungen weist der Akku einen guten Zustand auf. Der ADAC zieht ein erstes Zwischenfazit.
Akku übertrifft Herstellerversprechen
Im Zentrum der Untersuchung steht der sogenannte State of Health (SOH), also der Gesundheitszustand des Akkus. Er gibt Auskunft darüber, wie viel der ursprünglichen Batteriekapazität nach intensiver Nutzung noch verfügbar ist. Der ermittelte SOH-Wert liegt beim ID.3 im Schnitt bei rund 91 Prozent – ermittelt über verschiedene Messmethoden, darunter das Auslesen des Batteriemanagementsystems, ein Ladezyklus-Test und die unabhängige Analyse durch Aviloo.
Das Ergebnis liegt deutlich über dem von Volkswagen definierten Mindestwert von 70 Prozent für diese Laufleistung. Auffällig: Die Akkuzellen wurden im Testalltag überdurchschnittlich beansprucht. Häufiges Schnellladen sowie regelmäßige Vollladungen auf 100 Prozent gehören zur Routine – Vorgehensweisen, die im Alltag oft als belastend für die Batterie gelten. Dennoch blieb die Degradation im Rahmen.
Reichweite stabil – dank Softwareupdates
Interessant ist auch die Entwicklung bei der Reichweite. Zwar ist die verfügbare Batteriekapazität leicht zurückgegangen, dennoch schafft der ID.3 annähernd die gleichen Reichweiten wie zu Beginn. Grund dafür sind Softwareupdates, die die Effizienz des Fahrzeugs verbessert haben. So sank der Verbrauch von ursprünglich 20 kWh/100 km auf 18,3 kWh/100 km – gemessen nach ADAC Ecotest-Kriterien.
Die positive Tendenz zeigt, welchen Einfluss das Energiemanagement auf die Praxistauglichkeit eines Elektroautos haben kann. Gleichzeitig verdeutlicht sie die Relevanz regelmäßiger Softwarepflege durch den Hersteller.
Verbesserungspotenzial gibt es jedoch bei der Thermomanagementsteuerung der Batterie. Obwohl der ID.3 serienmäßig mit einer Batterieheizung ausgestattet ist, fehlt dem Fahrer die Möglichkeit, diese gezielt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Besonders bei niedrigen Temperaturen führt das zu längere Ladepausen, da das System automatisch die Zellen vorkonditioniert – ein Eingriff, der sich durch ein Softwareupdate optimieren ließe. Neuere Modelle mit aktuellerer Softwareversion verfügen bereits über diese Option.
Reparaturen im Rahmen – Wartungskosten steigen
Trotz des insgesamt positiven Eindrucks traten einige kleinere Mängel auf. Ein Defekt der GPS-Antenne legte auch das eCall-Notrufsystem lahm – Kostenpunkt 525 Euro. Ein weiteres Softwareproblem verhinderte bei 158.000 Kilometern das Starten des Fahrzeugs, verursacht durch die automatische Türöffnung. Die Lösung: ein Softwareupdate.
Ein Defekt an der Ladeklappe wurde für 227 Euro behoben. Wartungstechnisch bleibt der ID.3 eher genügsam, doch auch das hat seinen Preis. Für die zweite Inspektion fielen 427 Euro an – zuzüglich etwa 200 Euro für den Service an der CO₂-Klimaanlage.
Der ADAC wird den Test weiterführen – insbesondere mit Blick auf das Verhalten der Batterie jenseits der Garantiegrenze. Neben der Beobachtung des SOH sollen auch künftige Reparaturen und deren Ursachen dokumentiert werden. Der ID.3 liefert damit nicht nur wertvolle Daten zur Langzeitnutzung eines Elektrofahrzeugs, sondern auch eine solide Grundlage für Werkstätten und Teilegroßhandel, um sich auf kommende Reparaturbilder einzustellen.
Zusätzliche Belastungsfaktoren im Testalltag
Ein besonderer Aspekt des ADAC-Dauertests liegt im ungeschönten Alltagsbetrieb des ID.3. Anders als bei normierten Prüfzyklen oder Laborversuchen wird das Fahrzeug im Realbetrieb eingesetzt – inklusive häufiger Kurzstrecken, Langstreckenfahrten, Schnellladezyklen und Vollladungen. Vorwiegend das regelmäßige Laden auf 100 Prozent gilt bei vielen Experten als kritisch, da es die Alterung der Zellen beschleunigen kann. Dass der Akku des ID.3 trotz dieser Belastungen einen SOH-Wert von rund 91 Prozent erreicht, liefert praxisnahe Erkenntnisse zur Robustheit der Batteriezellen im MEB-Baukasten. Werkstätten und Großhändler erhalten damit verlässliche Anhaltspunkte für den Umgang mit gebrauchten Hochvoltkomponenten im Aftermarket.
Mit dem Erreichen der Garantiegrenze des Akkus wird der ID.3 zunehmend auch für den Gebrauchtwagenmarkt interessant. Die positive Bilanz hinsichtlich der Batteriegesundheit könnte sich als entscheidender Faktor bei der Wertermittlung etablieren. Käufer gebrauchter E-Fahrzeuge achten verstärkt auf Akkuzustand, Reichweite und Softwarestand – Bereiche, in denen der ID.3 punkten kann. Der ADAC-Test liefert dafür belastbare Daten. Gleichzeitig steigt die Bedeutung qualifizierter Diagnoseverfahren wie die von Aviloo oder herstellerunabhängige SOH-Analysen, die im Handel künftig eine zentrale Rolle bei der Bewertung von Elektrofahrzeugen spielen werden.
Hochvolt-Komponenten im Werkstattalltag
Für Werkstätten bringt der Dauertest zusätzliche Erfahrungswerte zu typischen Schwachstellen und notwendigen Reparaturen bei Elektrofahrzeugen. Die beschriebenen Probleme – etwa bei Türsteuerung, GPS-Antenne oder Ladeklappe – betreffen klassische Komfortsysteme, die auch in Verbrennerfahrzeugen zu finden sind. Der Unterschied liegt jedoch im Aufwand bei Diagnose und Reparatur, da viele Fehlerursachen softwarebasiert sind. Hier zeigt sich, wie wichtig geschultes Personal und ein tieferes Verständnis für die digitalen Fahrzeugarchitekturen sind. Auch bei einfachen Reparaturen wird deutlich: Ohne Zugriff auf Softwareupdates oder geeignete Diagnosetools lassen sich viele Probleme nicht nachhaltig beheben.
Ein zentrales Ergebnis des Langzeittests betrifft die kontinuierliche Verbesserung der Fahrzeugfunktionen durch Softwareupdates. Die Reduktion des Stromverbrauchs von 20 auf 18,3 kWh/100 km zeigt, welches Potenzial im digitalen Fahrzeugmanagement steckt. Software spielt bei modernen E-Fahrzeugen eine ebenso große Rolle wie klassische mechanische Komponenten. Die Herausforderung für Werkstätten: Während Ölwechsel, Bremsenservice oder Klimawartung standardisierte Abläufe bleiben, verändert sich die Fehlerdiagnose mit jedem neuen Softwarestand. Wer als Betrieb im Umgang mit MEB-Fahrzeugen wie dem ID.3 kompetent auftreten will, muss nicht nur Zugriff auf die passende Diagnosetechnik haben, sondern auch den Umgang mit digitalen Updates und Protokollen beherrschen.
Fazit
Der ID.3 zeigt nach über 160.000 Kilometern im ADAC-Dauertest eine starke Performance, vornehmlich beim Zustand der Hochvolt-Batterie. Trotz fordernder Testbedingungen bleibt der Akku effizient und zuverlässig. Das spricht für die Langzeitqualität des Fahrzeugs. Kritikpunkte wie das fehlende manuelle Batteriethermomanagement oder einzelne Softwarefehler sollten seitens des Herstellers künftig nachgebessert werden. Für Werkstätten bleibt das Fahrzeug wartungsarm, aber nicht völlig störungsfrei. Quelle: ADAC