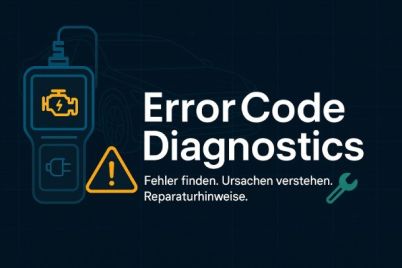Mit dem Projekt LAURIN wurde am DEKRA-Testareal Lausitzring eine neue Plattform geschaffen, die realitätsnahe Verkehrsszenarien in einer kontrollierten Umgebung reproduzierbar macht. Ziel war es, automatisierte Fahrfunktionen durch gezielte Tests unter anspruchsvollen Bedingungen abzusichern. Dabei kamen modernste Technologien aus Vermessung, Kommunikation und Steuerung zum Einsatz – koordiniert von einem Konsortium mit Fachkompetenz aus Industrie und Forschung.
Testumgebung mit realitätsnaher Dynamik
Im Fokus des Projekts standen komplexe Fahrversuche, bei denen unterschiedliche Verkehrsteilnehmer künstlich erzeugt und gesteuert werden. Dabei werden sowohl seriennahe Fahrzeuge mit Robotikkomponenten als auch mobile Plattformen verwendet, die beispielsweise Fußgänger oder Radfahrer simulieren. Diese Elemente bewegen sich koordiniert über das Gelände und bringen das Testfahrzeug gezielt in kritische Situationen.
Durch ein präzises Steuerungssystem lassen sich Bewegungsmuster so gestalten, dass verschiedene Verkehrskonstellationen realistisch abgebildet werden – etwa Spurwechsel, dichtes Auffahren oder Ausweichmanöver. Ein Demonstrationsszenario über mehrere Streckenabschnitte zeigt, dass die getesteten Fahrfunktionen dabei in Echtzeit reagieren müssen. Die Abläufe sind so abgestimmt, dass sich alle Elemente mit hoher Genauigkeit wiederholen lassen – ein entscheidender Aspekt für Vergleichstests und Serienentwicklung.
Ein wesentlicher Fortschritt im Rahmen des Projekts war die digitale Erfassung des gesamten Testareals. Mithilfe moderner Vermessungstechnologien wurde eine digitale Kopie der Testumgebung erstellt, die auch für Simulationen genutzt werden kann. Damit lassen sich Testszenarien nicht nur vor Ort durchführen, sondern auch softwareseitig vorbereiten und auswerten.
Darüber hinaus wurde gezeigt, wie reale Unfallkonstellationen aus Verkehrsdatenbanken für Versuchszwecke nutzbar gemacht werden. Mithilfe automatisierter Analysen konnten diese Unfalldaten so aufbereitet werden, dass sie auf das Testgelände übertragen und dort nachgestellt werden konnten. Die Umsetzung erfolgte über eine intelligente Kombination aus Softwaremodulen, Streckenplanung und Robotiksteuerung.
Vernetzung durch 5G und zentrale Steuerung
Für die präzise Koordination aller Testelemente wurde eine Leitstandlösung entwickelt, mit der sämtliche Einheiten zentral überwacht und gesteuert werden können. Die Kommunikation erfolgt über ein speziell eingerichtetes 5G-Netz, das auf dem gesamten Testgelände verfügbar ist. Die extrem geringe Verzögerung dieses Netzwerks ist notwendig, um in schnell wechselnden Verkehrssituationen zuverlässig reagieren zu können.
Diese Beteiligung mehrerer Partner mit spezifischem Know-how – von der Robotik über die Telekommunikation bis zur Simulation – machte es möglich, ein Gesamtsystem zu entwickeln, das in dieser Form einzigartig ist. Die Projektbeteiligten sehen in dieser Vernetzung eine tragfähige Grundlage für künftige Entwicklungen im Bereich des hochautomatisierten Fahrens.
Das Projekt LAURIN beweist, dass die Erprobung automatisierter Systeme nicht mehr ausschließlich auf der Straße erfolgen muss. Die realitätsnahe Nachbildung von Verkehrssituationen auf dem Testgelände schafft einen sicheren und kontrollierbaren Rahmen für intensive Funktionsprüfungen. Gleichzeitig ermöglicht die Digitalisierung des Testprozesses eine enge Verzahnung mit virtuellen Entwicklungsprozessen.
Mit dem erfolgreichen Projektabschluss steht eine Infrastruktur bereit, die auch für Hersteller und Zulieferer neue Wege in der Absicherung von Fahrfunktionen eröffnet. Zukünftige Weiterentwicklungen könnten eine noch engere Kopplung von Simulation und Realität ermöglichen und auch komplexere Verkehrssituationen oder weitere Verkehrsteilnehmerklassen einbeziehen.
Integration in Fahrzeugentwicklung und Zulassungsprozesse
Ein wesentlicher Nutzen der im Projekt entwickelten Testmethodik liegt in der frühzeitigen Integration in bestehende Entwicklungs- und Prüfprozesse. Hersteller automatisierter Fahrfunktionen müssen heute umfangreiche Nachweise erbringen, um die Zulassung ihrer Systeme zu erhalten – insbesondere, wenn es um Funktionen wie das automatisierte Spurhalten auf Schnellstraßen geht. Die Schwarmtests liefern dafür standardisierbare und nachvollziehbare Testdaten, die regulatorisch verwertbar sind. Damit lassen sich Validierungen zielgerichteter durchführen und Entwicklungszyklen effizienter gestalten, vornehmlich bei softwareintensiven Systemarchitekturen.
Die eingesetzte Testarchitektur ist so konzipiert, dass sie nicht auf eine bestimmte Fahrzeugklasse beschränkt ist. Vom Pkw über leichte Nutzfahrzeuge bis hin zu automatisierten Shuttles lassen sich unterschiedlichste Fahrzeugtypen in das Testsystem einbinden. Durch anpassbare Bewegungsprofile und flexible Simulationseinheiten können auch spezielle Einsatzzwecke wie urbane Mobilität, Werksverkehre oder automatisierte Logistiklösungen abgebildet werden. Diese Skalierbarkeit macht das System nicht nur für die klassische Fahrzeugentwicklung interessant, sondern auch für neue Mobilitätskonzepte.
Sicherheitsgewinn durch realitätsnahe Testszenarien
Ein zentrales Argument für den Ansatz von LAURIN ist der Sicherheitsgewinn. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prüfverfahren oder reinen Simulationen lassen sich mit den Schwarmtests Situationen erzeugen, die in der Realität zwar selten, aber besonders sicherheitskritisch sind. Dazu zählen etwa plötzlich auftretende Hindernisse, unklare Vorfahrtslagen oder das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer bei schlechten Sichtverhältnissen. Das gezielte Testen dieser Szenarien ermöglicht es, Fahrfunktionen so weiterzuentwickeln, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten – ein entscheidender Schritt für die gesellschaftliche Akzeptanz automatisierter Systeme.
Mit dem DEKRA Lausitzring als Testbasis positioniert sich Deutschland weiterhin als führender Standort für Entwicklung, Prüfung und Zulassung automatisierter Fahrzeuge. Die enge Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden – wie sie im Projekt LAURIN vorgelebt wurde – zeigt, wie innovationsfördernde Infrastrukturprojekte konkret umgesetzt werden können. Zudem wirkt die Investition in digitale Testumgebungen als Impulsgeber für andere Regionen und Forschungseinrichtungen. Der Ausbau solcher Infrastrukturen ist nicht nur technologisch relevant, sondern auch wirtschaftlich von Bedeutung für die Positionierung des Standorts im globalen Wettbewerb um Mobilitätsinnovationen.
Fazit
Das Forschungsprojekt LAURIN hat gezeigt, wie sich hochautomatisierte Fahrfunktionen unter realitätsnahen, kontrollierten Bedingungen testen und validieren lassen. Durch die Kombination aus digitalisierter Infrastruktur, präziser Robotiksteuerung und 5G-basierter Kommunikation ist ein Testsystem entstanden, das neue Maßstäbe für Reproduzierbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheitsniveau setzt. Die Möglichkeit, reale Unfallszenarien technisch nachzubilden und mithilfe eines digitalen Zwillings zwischen Simulation und physischem Versuch zu wechseln, eröffnet weitreichende Perspektiven für Entwicklung, Zulassung und Qualitätssicherung. Darüber hinaus stärkt das Projekt nicht nur die technologische Kompetenz der beteiligten Partner, sondern unterstreicht auch die strategische Bedeutung Deutschlands als Standort für zukunftsweisende Fahrzeugprüfung. Quelle: DEKRA