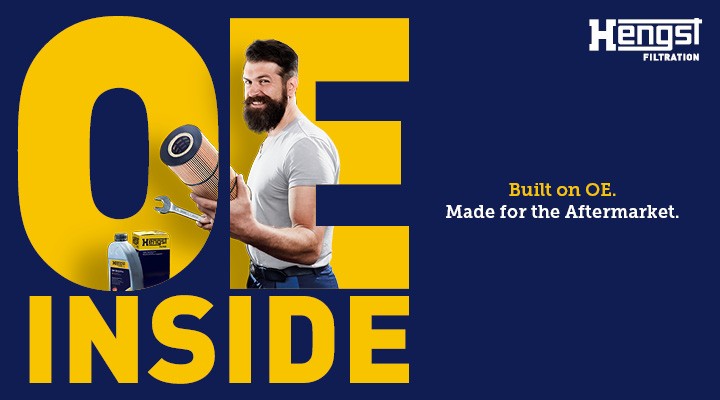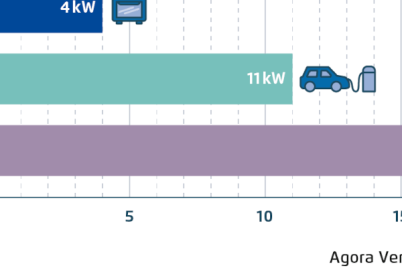Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) positioniert sich mit einem aktuellen Impulspapier zur Zukunft der Elektromobilität. Anlass ist der anhaltend schleppende Markthochlauf batterieelektrischer Fahrzeuge trotz positiver Zulassungszahlen. Auf dem 25. Automobildialog in Berlin forderte der Verband konkrete Maßnahmen zur Förderung praxistauglicher E-Mobilität. Der Fokus liegt auf Ladeinfrastruktur, wirtschaftlicher Attraktivität, technischer Transparenz und Bildung.
Mangelnde Planungssicherheit bremst das Kfz-Gewerbe
Die Elektromobilität gilt als zentrale Säule der zukünftigen Antriebstechnologie – doch in der Fläche fehlt es an Durchschlagskraft. Der ZDK macht hierfür in erster Linie unklare politische Signale verantwortlich. Zwar steigen die Neuzulassungen batterieelektrischer Fahrzeuge kontinuierlich, ein nachhaltiger Markthochlauf findet jedoch nicht statt. Aus Sicht des Verbands bleibt die Bundesregierung Antworten auf entscheidende Fragen schuldig: Wie werden Investitionen in Ladeinfrastruktur gefördert? Welche Anreize erhalten Verbraucher? Wie wird die technische Zukunftssicherheit abgesichert?
ZDK-Präsident Thomas Peckruhn betont, dass das Kfz-Gewerbe bereit sei, seinen Beitrag zum Wandel zu leisten. Dazu seien jedoch verlässliche Rahmenbedingungen notwendig, insbesondere für mittelständische Betriebe, die Planungssicherheit für Werkstattmodernisierung, Personalentwicklung und Kundenberatung benötigen.
Ein Kernpunkt im Positionspapier „Elektromobilität für Alle“ ist der beschleunigte Ausbau einer benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Der ZDK fordert weniger bürokratische Hürden und mehr rechtliche Klarheit – vornehmlich bei der Förderung privater Ladelösungen. Einheitliche Standards für Bedienung und Abrechnung sollen den Zugang erleichtern, nicht zuletzt im ländlichen Raum. Besonders private Ladepunkte in Wohnanlagen, Mehrfamilienhäusern oder auf Betriebsgeländen könnten durch schlankere Verfahren und gezielte Fördermittel deutlich schneller realisiert werden.
Auch wirtschaftlich müsse die Elektromobilität attraktiver gestaltet werden. Der ZDK schlägt gezielte Kaufprämien sowie eine Entlastung bei Stromsteuern und Netzentgelten vor. Dabei spielt Transparenz eine zentrale Rolle: Einheitliche Preisangaben, klare Abrechnungssysteme und verlässliche Reichweitenangaben stärken das Vertrauen der Kundschaft.
Darüber hinaus fordert der Verband verbindliche Standards für die Bewertung von Traktionsbatterien. Ein digitaler Batteriepass könnte helfen, Restwerte besser einzuschätzen und so die Attraktivität von Gebrauchtfahrzeugen erhöhen.
Werkstattbindung durch Reparaturkompetenz und Recycling
Neben dem Neuwagenverkauf sieht der ZDK speziell in der Reparatur und im Batterie-Recycling Potenzial, um Elektromobilität langfristig effizient und nachhaltig zu gestalten. Voraussetzung dafür ist der freie Zugang zu technischen Informationen und standardisierten Diagnosedaten – auch für freie Werkstätten. Der Verband fordert eine klare Regelung, damit Betriebe bei Rücknahme und Instandsetzung von Hochvoltkomponenten stärker eingebunden werden.
Ein zukunftsfester Wandel gelingt nur mit gut ausgebildetem Personal. Der ZDK warnt vor einem Fachkräftemangel im Bereich der Hochvolttechnik und spricht sich für eine Modernisierung der Bildungslandschaft aus. Dazu zählen der Aufbau leistungsfähiger Bildungszentren, die Ausstattung mit aktueller Technik sowie die Schulung von Ausbilderinnen und Ausbildern auf dem neuesten Stand. Nur so können junge Fachkräfte praxisnah auf die Anforderungen der E-Mobilität vorbereitet werden.
Der Mittelstand bildet das Rückgrat des deutschen Kfz-Gewerbes. Gerade freie Werkstätten, familiengeführte Betriebe und mittelständische Handelsunternehmen tragen einen erheblichen Teil der Serviceinfrastruktur. Ihre Rolle bei der Verbreitung von Elektromobilität ist entscheidend – etwa bei der Beratung zu E-Fahrzeugen, der Installation von Ladepunkten oder der Wartung von Hochvoltsystemen. Der ZDK warnt davor, dass viele dieser Betriebe ohne gezielte Unterstützung Gefahr laufen, den Anschluss an die technische Entwicklung zu verlieren. Förderprogramme und steuerliche Anreize müssen deshalb auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten werden.
Ein weiterer Hebel für den Erfolg der Elektromobilität liegt auf kommunaler Ebene. Städte und Gemeinden sind zentrale Akteure, wenn es um Ladeinfrastruktur, Parkraumbewirtschaftung oder den Einsatz von E-Fahrzeugen im öffentlichen Fuhrpark geht. Der ZDK sieht hier erhebliches Potenzial, um regionale Vorbilder zu schaffen und Vertrauen in die Alltagstauglichkeit der Technik zu stärken. Gleichzeitig fordert der Verband, dass kommunale Förderungen nicht nur Großflotten zugutekommen, sondern auch Handwerksbetriebe und Einzelunternehmen einbezogen werden – etwa bei der Umstellung auf E-Transporter im Lieferverkehr oder der Integration von Ladepunkten an betrieblichen Standorten.
Schnittstelle Energie- und Verkehrspolitik stärker verzahnen
Die Zukunft der Elektromobilität hängt nicht nur von der Automobil- und Infrastrukturpolitik ab, sondern auch von energiepolitischen Entscheidungen. Der ZDK fordert eine engere Verzahnung beider Bereiche, um den Betrieb von Elektrofahrzeugen langfristig wirtschaftlich zu gestalten. Dazu zählt insbesondere die Absenkung von Stromnebenkosten, die faire Gestaltung von Netzentgelten und die Einführung zeitvariabler Stromtarife für Ladevorgänge. Gleichzeitig braucht es Investitionen in das Stromnetz, um Lastspitzen abzufedern und bidirektionales Laden zu ermöglichen. Das Kfz-Gewerbe plädiert für eine koordinierte Strategie, die technische, regulatorische und wirtschaftliche Aspekte bündelt.
Ein oft unterschätzter Bereich ist der Gebrauchtwagenmarkt. Wenn Elektromobilität in der Breite ankommen soll, müssen auch gebrauchte E-Fahrzeuge attraktiv und verlässlich handelbar sein. Der ZDK fordert daher verbindliche Standards zur Bewertung von Traktionsbatterien, damit Käufer fundierte Entscheidungen treffen können. Ein digitaler Batteriepass – herstellerübergreifend und transparent – wäre ein entscheidender Schritt in diese Richtung. Zudem sollten Gebrauchtwagenförderungen geprüft werden, um den Einstieg in die Elektromobilität auch für preissensible Käufergruppen zu erleichtern. Das Kfz-Gewerbe sieht in einem funktionierenden Zweitmarkt einen entscheidenden Baustein für nachhaltiges Wachstum.
Fazit
Das Impulspapier des ZDK zeigt: Das Kfz-Gewerbe ist bereit, die Elektromobilität aktiv mitzugestalten – vorausgesetzt, die politischen Rahmenbedingungen stimmen. Ein erfolgreicher Wandel gelingt nur mit abgestimmten Maßnahmen, die sowohl technische Infrastruktur als auch wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Aspekte berücksichtigen. Der ZDK sendet ein deutliches Signal an die Bundesregierung: Ohne gezielte Impulse droht die Antriebswende in der Fläche zu scheitern. Quelle: ZDK