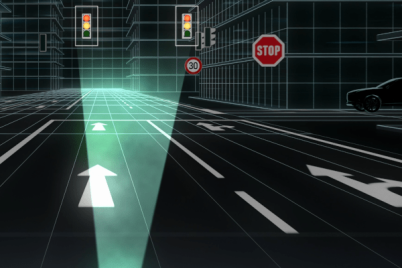Der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) zeigt sich tief enttäuscht über die Entscheidung der Bundesregierung, auf die im Koalitionsvertrag zugesagte Senkung der Stromsteuer zu verzichten. Nach dem Wegfall der Umweltprämie Ende 2023 markiert dieser Schritt einen weiteren Rückschlag für die Rahmenbedingungen der Elektromobilität in Deutschland. Trotz steigender Zulassungszahlen und wachsender Ladeinfrastruktur fehlt weiterhin eine konsequente und verlässliche Förderpolitik für E-Fahrzeuge – vor allem im privaten Bereich.
Versprechen gebrochen: Stromsteuer bleibt hoch
Die Stromsteuer für Privathaushalte zählt in Deutschland mit über 2 Cent pro Kilowattstunde zu den höchsten in Europa. Eine Reduzierung auf das europäische Mindestmaß von 0,1 Cent/kWh hätte nicht nur private Haushalte entlastet, sondern auch einen wichtigen Anreiz für den Umstieg auf batterieelektrische Fahrzeuge geschaffen. Im Koalitionsvertrag war diese Maßnahme klar vorgesehen – nun taucht sie weder im Bundeshaushalt 2025 noch in der mittelfristigen Finanzplanung auf. Die Ankündigung ihrer Rücknahme kommt für viele Marktteilnehmer überraschend und wirkt wie ein Rückfall in alte Muster einer inkonsequenten Förderpolitik.
Die Deutsche Automobil Treuhand (DAT) bestätigt in einer aktuellen Befragung, dass 57 Prozent der Autonutzer günstigere und einheitlichere Strompreise für relevanter halten als Kaufprämien. Dieser Trend unterstreicht die zentrale Rolle der Betriebskosten bei der Fahrzeugwahl. Eine mögliche Lösung, über die derzeit politisch diskutiert wird, ist die Einführung einer bundesweit gültigen Ladekarte mit Stromguthaben. Damit ließen sich nicht nur Preisdifferenzen an öffentlichen Ladepunkten verringern, sondern auch eine planbare Kostenstruktur für E-Mobilisten schaffen.
Ohne Preisvorteil verliert das E-Auto an Attraktivität
VDIK-Präsidentin Imelda Labbé betont, dass Strompreise entscheidend für die Attraktivität der Elektromobilität sind. Sobald die Kosten pro Kilometer dem Vergleich zu modernen Verbrennern nicht mehr standhalten, gerät das Geschäftsmodell ins Wanken. Das Ziel, klimaneutrale Mobilität massentauglich zu machen, rückt damit in weitere Ferne. Die jetzt gestrichene Steuerentlastung hätte vielen potenziellen E-Auto-Käufern ein zusätzliches Argument geliefert. Stattdessen bleibt das Risiko steigender Stromkosten beim Endkunden hängen.
Die Kritik am „Schlingerkurs“ der Bundesregierung ist nicht neu, gewinnt aber durch die aktuelle Entwicklung an Gewicht. Bereits das plötzliche Ende der Innovationsprämie Ende 2023 hatte für Verunsicherung in Handel und Werkstatt gesorgt. Nun folgt der nächste Kurswechsel, ohne Rücksicht auf die langfristigen Strategien von Herstellern, Händlern und Werkstätten. Die Elektromobilität bleibt in Deutschland ein politischer Spielball, statt auf stabilen Fördermechanismen zu fußen.
Versorgungsstruktur unter Druck: Öffentliche Ladeinfrastruktur bleibt kostenintensiv
Die Entscheidung gegen eine Stromsteuersenkung trifft nicht nur Endverbraucher, sondern auch Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur. Diese kalkulieren ihre Tarife auf Basis hoher Energiebezugskosten – inklusive Stromsteuer. Entfällt der steuerliche Entlastungsfaktor, bleiben die Strompreise an Schnellladesäulen weiterhin auf hohem Niveau. Gerade in ländlichen Regionen, in denen häufig nur wenige Ladepunkte zur Verfügung stehen, führt das zu einer Wettbewerbsverzerrung gegenüber klassischen Tankstellen. Die hohen Betriebskosten verhindern Investitionen in neue Standorte und verlangsamen den Netzausbau. Damit droht ein infrastrukturelles Ungleichgewicht zwischen urbanen Zentren und dem ländlichen Raum, das den flächendeckenden Hochlauf der Elektromobilität zusätzlich erschwert.
Auch aus industriepolitischer Sicht ist die Stromsteuer-Entscheidung ein negatives Signal. Während andere europäische Länder gezielt Maßnahmen zur Entlastung von Stromkunden umsetzen, bleibt Deutschland bei der Abgabenlast auf Energie eines der Schlusslichter. Das betrifft nicht nur private Verbraucher, sondern zunehmend auch kleine und mittlere Unternehmen – etwa Werkstätten mit eigener Ladeinfrastruktur oder Fahrzeugflotten im regionalen Lieferverkehr. Die hohen Stromkosten wirken sich direkt auf die Kalkulationen aus und schwächen die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Standorte. In einem Marktumfeld, das sich immer stärker an CO₂-Bilanzen und Gesamtkosten orientiert, kann dies langfristig auch Investitionsentscheidungen beeinflussen.
Verunsicherung beim Handel: Weniger Nachfrage nach E-Fahrzeugen erwartet
Der Kfz-Handel steht erneut vor der Herausforderung, Kunden ohne stabile Rahmenbedingungen für Elektromobilität zu beraten. Bereits das Ende der staatlichen Umweltprämie hatte für einen deutlichen Nachfragerückgang bei vollelektrischen Fahrzeugen gesorgt. Nun folgt mit dem Wegfall der Stromsteuersenkung das nächste Hemmnis – vor allem für preissensible Zielgruppen. Händler berichten zunehmend von Kunden, die aus Unsicherheit über Betriebskosten oder künftige Förderungen lieber bei bewährten Verbrennungstechnologien bleiben. Ohne klare politische Leitlinien fehlt die notwendige Planungssicherheit, um die Elektromobilität dauerhaft im Markt zu verankern. Dies betrifft nicht nur den Neuwagenvertrieb, sondern auch Leasing, Finanzierung und Beratung rund um die Ladeinfrastruktur.
Auch freie Werkstätten und Servicebetriebe sehen sich mit den Folgen der Stromsteuer-Entscheidung konfrontiert. Der Ausbau von Know-how und Infrastruktur für E-Fahrzeuge erfordert Investitionen – etwa in Hochvolt-Schulungen, Diagnosegeräte oder spezielle Sicherheitsausstattungen. Gleichzeitig bleibt unklar, ob die erwarteten Fahrzeugmengen tatsächlich im Markt ankommen werden. Das erhöht das wirtschaftliche Risiko für Betriebe, die sich frühzeitig auf E-Mobilität spezialisiert haben. Der jetzt ausbleibende steuerliche Impuls verschärft die Unsicherheit zusätzlich. Viele Werkstätten berichten bereits von rückläufigen Anfragen im Bereich E-Service oder einem stagnierenden Interesse an Umbauten von Ladeplätzen. Ohne ein stabiles politisches Fundament verliert die Branche an Perspektive – trotz technischer Bereitschaft.
Fazit
Mit der Absage an die Stromsteuersenkung vergibt die Bundesregierung die Chance, die Betriebskosten für E-Autos nachhaltig zu senken. Dabei ist längst klar, dass ein günstiger Strompreis für viele Käufer wichtiger ist als eine Einmalzahlung beim Fahrzeugkauf. Werkstätten und Großhandel müssen sich weiter auf volatile politische Rahmenbedingungen einstellen – und ihre Kunden mit unsicheren Preisprognosen für Strom konfrontieren. Der geplante Hochlauf der Elektromobilität droht so erneut an politischen Entscheidungen zu scheitern, statt an der Technik. Quelle: VDIK