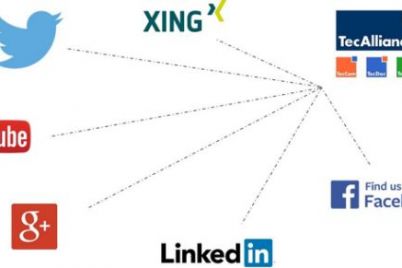Die aktuelle Debatte zur Überarbeitung der EU-Verordnung über Altfahrzeuge sorgt für Unruhe in der Kfz-Branche. Nach Angaben einer FIGIEFA Mitteilung, enthält der Standpunkt des Rates zum End of Life Vehicle (ELV) Vorschlag zahlreiche kritische Punkte. Trotz positiver Ansätze im Sinne der Kreislaufwirtschaft sieht der Verband sowohl technische Unschärfen als auch soziale Risiken – insbesondere durch die Einstufung reparabler Fahrzeuge als „irreparabel“.
Technisch reparierbare Fahrzeuge dürfen nicht voreilig aussortiert werden
In Anhang I der geplanten Verordnung wird geregelt, wann ein Fahrzeug als irreparabel und damit als Altfahrzeug gilt. Für FIGIEFA ist problematisch, dass Komponenten wie Reifen, Aufhängung, Bremsen oder Airbags als Ausschlusskriterium gelten, sofern deren Austausch oder Reparatur technisch nicht möglich sei. Diese Formulierung lasse den nötigen technischen Realitätsbezug vermissen.
Tatsächlich gehören genau diese Reparaturen zum täglichen Geschäft der rund 300.000 freien Werkstätten in der EU. Hier werden sicherheitsrelevante Komponenten regelmäßig erneuert – effizient, wirtschaftlich und unter Einhaltung aller Sicherheitsstandards. Die Einstufung solcher Fahrzeuge als irreparabel ignoriert somit das Fachwissen und die etablierten Reparaturprozesse im freien Werkstattnetz.
Stattdessen müsse – so die Forderung von FIGIEFA – gezielt dort angesetzt werden, wo eine Reparatur technisch wirklich ausgeschlossen ist. Alles andere untergräbt das Ziel der Nachhaltigkeit im Fahrzeugbestand und führt zu unnötigen Abfallmengen durch verfrühte Verschrottungen.
Soziale Schieflage durch das Kriterium der wirtschaftlichen Irreparabilität
Besonders kritisch sieht FIGIEFA den Vorschlag, auch wirtschaftliche Faktoren in die Bewertung einfließen zu lassen. Wenn die Kosten einer Reparatur den Marktwert des Fahrzeugs übersteigen, kann dieses nach dem Entwurf ebenfalls als irreparabel gelten – unabhängig davon, ob die Reparatur technisch möglich und sicher durchführbar wäre.
Dieses Kriterium trifft vor allem einkommensschwächere Haushalte. Denn genau diese Gruppen sind auf bezahlbare Gebrauchtfahrzeuge und preisgünstige Reparaturen angewiesen, um mobil zu bleiben. Eine wirtschaftliche Schwelle als Maßstab für Irreparabilität führt damit zu sozialer Ungleichheit – und verstärkt die Schere beim Zugang zur individuellen Mobilität.
Hinzu kommt ein ökologischer Aspekt: Die Verschrottung eines noch funktionstüchtigen Fahrzeugs ist immer mit Ressourcenverbrauch verbunden – sowohl bei der Entsorgung als auch bei der Produktion eines Neufahrzeugs. Die wirtschaftliche Irreparabilität als Kriterium widerspricht daher auch dem Ziel der Kreislaufwirtschaft.
Unabhängiger Aftermarket als Stütze einer nachhaltigen Mobilität
FIGIEFA betont die Bedeutung des Independent Aftermarket (IAM) für eine nachhaltige Fahrzeugnutzung. Freie Werkstätten und Ersatzteilanbieter leisten einen entscheidenden Beitrag zur Verlängerung der Lebensdauer von Fahrzeugen – unabhängig von Marke oder Alter. Diese Rolle müsse durch den Gesetzgeber gestärkt und nicht durch praxisferne Vorschriften eingeschränkt werden.
Eine funktionierende Ersatzteilversorgung und der Zugang zu Reparaturinformationen sind Grundpfeiler für einen ressourcenschonenden Umgang mit Fahrzeugen. Wird dieser Sektor geschwächt, steigen Reparaturkosten und geraten vor allem ältere Fahrzeuge zunehmend unter Druck.
Der Verband fordert daher eine Revision der Kriterien in Anhang I der Altfahrzeugverordnung. Insbesondere wirtschaftliche Faktoren sollten kein Ausschlussgrund für Reparaturen sein. Entscheidend sei, ob ein Fahrzeug sicher instand gesetzt werden kann – und nicht, ob sich die Reparatur ökonomisch „rechnet“.
Fehlende Differenzierung zwischen strukturellem und funktionalem Schaden
Ein weiteres Problem der aktuellen Entwurfsfassung ist die unzureichende Unterscheidung zwischen strukturellem und funktionalem Schaden. In der Praxis ist entscheidend, ob ein Fahrzeugrahmen oder tragende Karosseriestrukturen beschädigt sind – nicht jedoch, ob austauschbare Bauteile wie Bremskomponenten oder Federungssysteme betroffen sind. Letztere können mit Originalteilen oder qualitätsgeprüften IAM-Komponenten in den allermeisten Fällen problemlos ersetzt werden.
Die geplanten pauschalen Klassifizierungen ignorieren diese Feinheiten und führen dazu, dass selbst bei geringfügigen Schäden eine Ausmusterung droht. Für Werkstätten und Ersatzteillieferanten, die sich tagtäglich mit Schadensbildern und Instandsetzungsprozessen beschäftigen, ist eine solche pauschale Bewertung nicht nachvollziehbar und aus technischer Sicht nicht haltbar.
Ein Nebeneffekt der geplanten Verschärfung könnte eine empfindliche Störung der Gebrauchtfahrzeugmärkte in Europa sein. Wenn Fahrzeuge schneller als irreparabel eingestuft werden, schrumpft das Angebot an instandsetzungsfähigen Gebrauchtfahrzeugen. Das hat nicht nur Auswirkungen auf Endverbraucher, sondern auch auf den Ersatzteilmarkt, der auf die Demontage und Weiterverwendung gebrauchter Komponenten angewiesen ist.
Der Rückgang von reparierbaren Fahrzeugen trifft auch Wiederaufbereiter und Recycler. Zahlreiche Betriebe in diesem Bereich arbeiten daran, gebrauchte Teile wieder in den Wirtschaftskreislauf zu bringen – ressourcenschonend und wirtschaftlich. Eine undifferenzierte Definition von Altfahrzeugen setzt dieses etablierte System unter Druck und konterkariert das Ziel der Ressourcenschonung.
Fazit
Der aktuelle Entwurf der Altfahrzeugverordnung verkennt nach Einschätzung von FIGIEFA die technische Realität in der Werkstattpraxis und ignoriert die sozialen Folgen einer pauschalen Einstufung wirtschaftlich „unrentabler“ Fahrzeuge. Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft ist es essenziell, dass technisch machbare Reparaturen Vorrang vor finanziellen Bewertungsmaßstäben haben. Nur so lässt sich nachhaltige Mobilität gewährleisten – sowohl ökologisch als auch sozial. Quelle: FIGIEFA